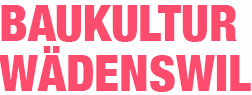MEINE JUGENDZEIT
Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2011 von Peter Weiss / Ruth Uebersax-Schärer
Diese Aufzeichnungen stammen von Ruth Uebersax-Schärer (18. Juni 1921 bis 22. März 2011) und wurden in ihrem Nachlass gefunden. Sie beschreiben Erlebnisse aus ihrer Kindheit im Wädenswiler Berg, wo sie als sechstes von insgesamt dreizehn Kindern des Ehepaares Heinrich und Lina Schärer-Staub auf dem kleinen Gehöft «Schluchtal» aufgewachsen war. Sie lernte Schneiderin, heiratete am 27. August 1942 Hilarius Rhyner, dem sie neun Kinder, zwei Töchter und sieben Söhne, schenkte. Sie war eine eindrückliche und tapfere Frau, die ihrem Gatten in jeder Situation tatkräftig zur Seite stand. Als sie den Hof «Im Wald» in Schönenberg in Pacht hatten, liess sie sich zur diplomierten Bäuerin ausbilden. Später absolvierte sie die Wirteprüfung und leitete ein Jugend- und Ferienhaus in Amden. Dort engagierte sie sich auch in der Kirchgemeinde als Organistin und als Kirchgemeinderätin.
Nach dem Tod ihres Gatten kurz vor Weihnachten 1978 fand sie in Werner Uebersax, einem ehemaligen Landwirt und Witwer aus Rütschelen BE, einen neuen Lebenspartner. 1984 feierten sie Hochzeit und zogen miteinander ins dortige «Stöckli». 1993 wurde Werner Uebersax für immer heimgerufen. Vier Jahre später kehrte Ruth nach Wädenswil zurück und lebte im selben Haus wie ihre älteste Tochter. Ihre letzten drei Jahre verbrachte sie im Alterszentrum Fuhr.
Peter Weiss
Heimwesen Schärer-Staub im Schluchtal, Wädenswiler Berg.
Als sechstes Kind wurde ich in einer Kleinbauernfamilie geboren. Vier Brüder und eine Schwester waren schon da. Das gab wahrhaftig viel Betrieb auf unserem Hof. Ich entwickelte mich eher als «Mutterhöckli», während meine Schwester sich gerne draussen mit den Buben tummelte. Ich war sehr gerne dabei, die Mutter pflegen zu helfen, wenn wieder ein Geschwisterchen angekommen war. Ich war immer hochbeglückt, so ein kleines Wesen im Stubenwagen zu begrüssen.
Einmal wollte mir der Vater eine Schwesternhaube um den Kopf binden. Da protestierte ich heftig: «Näi, käi Chrankeschwöschter, e Mueter möchti ich doch werde!» Mutterpflichten kamen noch eine ganze Menge auf mich zu. Wir hatten immer etwa zwei Kleine bei uns in der Kammer. Meine Schwester erwachte selten in der Nacht.
Lina und Heinrich Schärer-Staub.
So stand ich auf, setzte die Kleinen aufs Töpfchen oder legte sie wieder trocken. Das war ein grosses Plus für mich. Sie wurden mir viel anhänglicher. So wurde ich auf natürlichste Art belohnt.
Lina und Heinrich Schärer-Staub mit ihren 13 Kindern, zirka 1935. Ruth, stehend, Dritte von rechts.
WINTERFREUDEN
Viel Abwechslungsreiches brachten uns die schneereichen Winter. In unseren Schlafzimmern hatten wir oft wunderschöne Eisblumen an den Fenstern. An der Aussenseite klebte auch ein dicker Raureif. Da schrieben wir unsere Namen drauf oder machten lustige Zeichnungen. Wir Kinder durften immer ein warmes Tuch vom Ofen nehmen, um im Bett unsere Beine einzuwickeln, damit wir schneller warm hatten.
Pfaden im Winter 1977. Vorne auf dem Pferd Edwin Hottinger, hinten Max Schroth.
Pfaden im Burstel.
Pfaden an der Zugerstrasse im Burstel.
Oft weckte uns früh ein lautes Pferdegebimmel. Da wussten wir: Es hat geschneit. Schnell krochen wir aus den Betten, denn den Pflug mit den vier Pferden wollten wir unbedingt sehen. Nochmals kuschelten wir uns unter die Decken und freuten uns auf den herrlichen Schnee. Die Brüder waren tüchtig im Schneehüttenbauen. Gross und hoch musste sie sein, sodass wir alle Platz darin hatten. Dürres Brot und Dörrbirnen mundeten immer am besten im Schneehaus.
Der Vater sägte und spitzte für uns die «Fasstuugen» zu (Fassdaube, gebogenes Seitenbrett eines Fasses). Alte Velopneus fanden die Buben schon damals auf den Grümpelhaufen. Die dienten jetzt gut als Skibindungen. Jetzt ging es ans Einseifen. Wenn noch ein paar Kerzenstumpen zur Hand waren, wurden diese eingeschmolzen, sodass man ein grösseres Stück in der Hand halten konnte, um die Bretter zu wachsen.
Auf dem Nachbarhof gab es einen steilen Hang, da wurde geübt. Bald waren diese Abfahrten für die Brüder zu wenig spannend. Nun wurden Schanzen gebaut, immer höher und höher, und die Sprünge wurden länger. Manchmal sauste so eine «Fasstuuge» allein den Berg hinunter, aber dem halfen wir ab. Wir banden die Bindungen mit Schnüren an unsere Beine. Ich wurde nie tüchtig im Skifahren und gab es später auch auf. Wir hatten sowieso immer zu wenig Bretter für die vielen Beine.
Die Nebenstrassen waren oft sehr eisig. Das gab die tollsten Schlittenfahrten. So vertrauten wir uns eines Tages einem älteren Bruder an. Es gab eine verrückte Fahrt hinter unserer Scheune hinunter zum Bach. Zum Glück sah der Vater unseren Schuss und ahnte nichts Gutes. Er rannte uns nach, so gut er konnte. Vor der Brücke verloren wir die Herrschaft über den Schlitten, sausten das Bord hinunter durchs Gebüsch und ich als Vorderste schlug mit dem Kopf aufs Eis und sank ins Wasser. Die andern zwei konnten herausklettern, und schon stand der Vater da und holte mich aus den eiskalten Fluten. Ich war bewusstlos. Erst zu Hause erwachte ich wieder, als sie die nassen Kleider von mir nahmen. Jetzt rieben sie meinen Körper warm, wickelten mich in ein warmes Barchent-Betttuch und steckten mich ins Ofenrohr. Hier versank ich in einen wohligen Schlaf. Meine Eltern waren unendlich dankbar, dass alles gut ausgegangen war.
WEIHNACHTSZEIT
Die Vorweihnachtsfreude war gross. Alle Tage kamen Päckli. Gotte und Götti vergassen ihre Kinder nicht. Und endlich kam der grosse Tag. Schon am Morgen war es herrlich, in der sauber gefegten Stube den schön geschmückten Christbaum zu begrüssen. Allzu langsam ging der Tag vorbei. Der Vater ging früh in den Stall und die Buben halfen ihm. Am Abend kamen die Tanten auf Besuch, legten jedes Jahr allen Kindern ein eigenes Stoffsäcklein auf den Tisch, gefüllt mit Orangen, Mandarinen, Feigen, Nüssen und kleinen Schöggeli – jedes Jahr dieses kleine «Wundersäckli».
Der Vater las immer zuerst die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, sprach ein kurzes Dankgebet für all die guten Gaben, die neben dem Christbaum aufgetürmt lagen. Nachher sangen wir die üblichen Weihnachtslieder. Die Tanten freuten sich immer, wenn wir die Sonntagsschulverse wiederholten. Dann ging es endlich ans Auspacken. Natürlich kamen keine Spielsachen zum Vorschein, das wussten wir alle. Wir waren tief beglückt über die warmen, zum Teil selbst gestrickten Sachen.
Einmal an Weihnachten wollte mein Bruder Fritz nicht in die Weihnachtsstube kommen. Er hatte sich innig einen Modellflieger gewünscht, doch die Mutter sagte ihm, das sei doch nicht möglich. Seine Gotte konnte ihn überreden, trotzdem in die Stube zu kommen, und zu seinem grossen Erstaunen hing ein Flugzeug an der Decke.
Den Propeller konnte er sogar aufziehen und der Flieger sauste vom Estrich über alle Obstbäume hinweg. Das war das erste und für längere Zeit des letzte Spielzeug in unserer Stube.
Die Fliegerei wurde darum so aktuell, weil etliche Male der Zeppelin unsere Gegend unsicher machte. Da konnten wir gar nicht genug rennen, um ihn so lange wie möglich zu sehen. Wir waren damals sehr traurig, als es hiess, er sei verbrannt.
Luftschiff Graf Zeppelin über Wädenswil.
MUTTERS ERZÄHLEN UND BETEN
An schulfreien Nachmittagen, wenn das Wetter schlecht war, sassen wir oft um den grossen Familientisch – auch Nachbarskinder waren oft dabei. Die Kleinsten machten meistens ihren Mittagsschlaf. Die Mutter nahm den grossen Flickkorb zu sich und nun ging es ans Geschichtenerzählen. Sie konnte die Geschichten ja nur so aus dem Ärmel schütteln. So wenigstens empfanden wir es als Kinder. Sie erzählte uns die Märchen. Auch wahre Geschichten liebten wir sehr. Erstaunlich viel wusste sie aus fremden Ländern zu berichten, wo Missionare das Christentum hinzubringen versuchten. Es kam ja noch vor, dass dort Eltern ihre Kinder oder Jünglinge den Götzen opferten oder Häuptlinge Menschen mit der schwarzen Magie in den Tod trieben. Viele Menschen lebten dort in grössten Ängsten. Auch mit biblischen Geschichten machte uns die Mutter vertraut. Am Abend sass sie oft auf dem Bettrand und wir – sechs bis sieben Kinder – krochen unter die gleiche Bettdecke. Wir konnten nie genug Geschichten hören.
Nachher kam sie in jede Kammer, um mit uns zu beten. Einmal waren wir nicht gehorsam. Da hiess es: Heute kommt eure Mutter nicht auf eure Kammern um zu beten. Das war eine harte Strafe. Wir schlichen leise die Ofentreppe hinauf. Ein Bruder schluchzte und rief immer wieder: «Mueter, chum cho bätte! Mueter, chum cho bätte!» Jetzt weinte ich auch. Ich kroch unter die Decke, um diesen kläglichen Ruf nicht mehr zu hören. Weit weg wurde er immer leiser und wir schliefen alle ein. Später erklärte uns die Mutter, wie wichtig es sei, dass Kinder gehorchen lernten. Gott wünsche es auch von seinen grossen Kindern, dass sie seine Gebote beachten.
DER WINTER IST VORBEI
Im Vorfrühling kam die Brennerei – das war immer so etwas Geheimnisvolles. Wir wussten gar nicht recht, was in diesen glänzenden Kesseln vor sich ging. Da wurde ja der Trester, der im Herbst in alte Mostfässer eingelagert worden war, gebrannt.
Auf uns Kinder wartete wieder viel Arbeit. Jedes Kind bekam eine Büchse. Die mussten wir mit gebranntem Trester füllen, tüchtig pressen und die Büchse auf ein Brett stürzen. Diese «Stöckli» legte der Vater auf ein luftiges Gestell, wo sie über den Sommer austrocknen konnten. Sie waren für uns ein wertvolles Brennmaterial, das die Glut sehr lange hielt. Später gab es eine Maschine, von Hand zu drehen. Oben war ein grosses Einfüllloch und vorn kamen die gepressten «Stöckli» heraus. In der Mitte hatten sie erst noch ein Loch, damit sie schneller trockneten.
DER ERSTE KUCKUCKSRUF UND SEINE FOLGEN
Im Frühling warteten wir immer gespannt auf den ersten Kuckucksruf. Dann rissen wir unsere Holzböden von den Füssen und freuten uns aufs Barfussgehen. Mutter erklärte uns: Erst wenn der Kuckuck ruft, ist die Wärme im Boden. Das «Baarfislaufe» brachte allerlei mit sich. Die Nägel, die wir an den Holzböden im Winter verloren, blieben dort liegen, wo wir uns im Sommer bewegten.
An einem Morgen waren wir spät dran für die Schule. Wir rannten, aber der kleine Werner mochte nicht mithalten. Er kam zu spät. Kaum war er unter der Türe, schimpfte ihn der Lehrer tüchtig aus. Aber als er sah, wie er an den Platz humpelte, tat es ihm leid. Er schaute nach seinem Fuss. Da entdeckte er eine Blutvergiftung – der rote Strich ging schon übers Knie. Jetzt aber wurde der Lehrer sanft. Ich musste mit Werner zur Lehrersfrau in die Wohnung. Sie müsse ihm ein Schmierseifenbad machen und nachher mit Zugsalbe gut zubinden. Nachher durfte Werner auf dem Ruhebett liegen bleiben bis die Schule fertig war. Dann schickte der Lehrer zwei starke Buben in den Keller, um den Leiterwagen zu holen, und mein kleiner Bruder durfte heimgefahren werden.
Blutvergiftungen hatten wir etliche Male. Wir heilten sie immer mit derselben Methode. Manchmal hatten wir schon Angst wegen dem Starrkrampf. Der Schnaps war schon gut gegen vieles, aber gegen dieses Übel reichte er nicht. Husten hatten wir auch öfter – da gab es einen heissen «Schmutzblätz» auf die Brust. Warme Zwiebelwickel heilten Hals-, Ohren- und Zahnschmerzen. Wenn wir fieberten, gab es Tee und zwei bis drei Tage nichts zu essen, da Nahrung für den fiebrigen Körper nachteilig sei. Zwei Brüder hatten Lungenentzündung. Da wurden sie in feuchte Tücher gewickelt und an die Füsse gab es Essigwickel. Es gab Krisennächte, aber zum Glück durften jeweils alle wieder gesund werden.
DES NACHBARS PFERD
Eine zugezogene Bernerfamilie hatte zwei Pferde. Ihr Hof war viel grösser als der unsrige. Für uns waren Pferde etwas Aussergewöhnliches. Wir mussten noch Kühe einspannen. Somit bestaunten wir oft dieses Pferdegespann.
Wieder einmal umringten wir das volle Jauchefass mit den Rossen. Der Bauer warnte uns noch: «Kommt nicht zu nah!» Aber da passierte es halt doch. Irgendwie stürzte meine Schwester gerade vor das Wagenrad. Ein Bein und einen Arm hat es erwischt.
Zum Glück war eine Tante auf Besuch. Sie konnte sofort die gebrochenen Glieder einschienen für den Transport. Der Arzt lud die Schwester dann ins Auto und brachte sie ins Spital. Nun durften wir dort manchmal Besuche machen, wodurch unser ja kleiner Horizont etwas erweitert wurde.
GASTFREUNDSCHAFT
Bei uns gingen viele Leute ein und aus. Wir wohnten an einer Hauptstrasse. Wallfahrer, Zigeuner, Landstreicher, Arbeitsuchende, Hausierer, Alkoholiker wurden während der Mittags- oder Abendessenszeit an den Tisch genommen. Immer noch höre ich folgende Worte in meinen Ohren: «Rutsched zäme, Chinde, es chunt na en Gascht!» Manchmal hätten wir am liebsten die Nase zugehalten, so haben gewisse Leute gestunken. Aber eben, Gäste behandelt man vornehm. Zerrissene Kleider wurden von der Mutter notdürftig geflickt. Müde Gäste erhielten ein Nachtlager. Wenn Pfeife oder Zündhölzli vorhanden waren, nahm sie der Vater ihnen ab. Er machte ein weiches Strohlager im Stall und gab ihnen eine alte Decke.
Wenn Frauen von ihrer Pilgerreise von Deutschland Richtung Einsiedeln müde waren, wurde ein Zimmer für sie sauber bezogen und die Buben schlüpften anderswo unter die Decken.
Die Metzger- und Bäckerlehrlinge oder Ausläufer fanden bei der Mutter immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen. Sie hatten es nicht immer leicht und wurden oft verprügelt – nicht gerade von den Meistersleuten, aber die Gesellen gingen manchmal recht grob mit ihnen um. Auch plagte sie oft das Heimweh. Nur zu gut wusste die Mutter, wie es so Bubenherzen zumute war, denn auch ihre älteren Buben mussten mit dreizehn Jahren ihr Brot verdienen. In den Nachbargemeinden war in der 7. und 8. Klasse im Sommer nur an zwei Vormittagen in der Woche Schule. Somit konnten die Knaben auf den Bauernhöfen schon viel helfen. Ein Bruder, der weiter weg war, hatte furchtbares Heimweh. Sein Kissen sei nass gewesen vor Tränen, denn die Bäuerin war sehr hart mit ihm. Zum Glück schenkte ihm jemand eine Mundharmonika. So schlüpfte er jeweils unter die Decke und spielte, bis er einschlief.
FREMDER GEIST
Mein ältester Bruder kam für einen Tag heim. Ich sprang ihm voll Freuden entgegen und erzählte ihm, dass wieder ein kleines Mädchen gekommen sei. Er aber erwiderte hart: «Rüered dä Chäib is Schiissiloch abe!» Wir waren furchtbar entsetzt über solche Worte. Er war für uns wie ein Fremder geworden. «Mich lachen sie aus wegen der vielen Goofen, er sei ein blöder Dummkopf, dass er noch heimgehe und erst noch den Lohn dem Alten bringe, so etwas Idiotisches würden sie nie tun.» Er warf den Zahltag auf den Tisch. Der Vater dankte ihm und gab ihm wie immer seine fünf Franken Sackgeld. Meine Eltern nahmen all diese Worte still auf, waren lieb mit ihrem Ältesten und konnten ihn gut verstehen.
Zwei Jahre später liebkoste das kleine dunkeläugige Mädeli seinen grossen Bruder. Die Mutter sagte sanft: «Gäll Heiri, es wär doch schaad gsii um das lieblichi Gschöpf.» Er drückte verlegen das Kind an sich und gab ihm einen Kuss. «Es Chind isch e käi Lascht, es Chind isch en Himelsgascht», hörten wir die Mutter oft sagen.
Ruth Uebersax-Rhyner-Schärer und Lina Bütikofer-Schärer, Schwester.
EINE AUSHILFE
Für die jährliche Generalreinigung des Hauses war es schon gut, wenn die Mutter Hilfe bekam. Nur war es nicht leicht, neben der grossen Haushaltung sieben Zimmer zu sonnen und zu fegen. Auch musste die grosse Küche jedes Jahr geweisselt werden. Manchmal ging es so recht drunter und drüber, vor allem für jemanden Aussenstehenden.
Die gute Käthi – Schwester meiner Mutter – wusste manchmal kaum, wo ihr der Kopf stand. Sie wollte uns Kinder dressieren und das gelang ihr halt nicht. Als sie einmal einem Bruder einen Klaps geben wollte, floh dieser aus dem Haus, kletterte wie ein Wiesel das Dach hinauf, setzte sich auf den Kamin und rief: «Jetzt kannst du mich ja holen!» Sie aber drohte, sie werde es dem Vater sagen. Fritzchen kratzte sich in den Haaren und sagte sich: «Schon lieber einen Klaps von einer Frau als einen dreimal stärkeren vom Vater» und schlich sachte wieder vom Dach herunter.
Käthi war ungeheuer tüchtig, schuftete, was ihre Kräfte hergaben, doch geriet sie manchmal aus allen Fugen, wenn wir Kinder nicht gerade so waren, wie sie es wünschte. So schmetterte sie eines Tages der Mutter die Worte entgegen: «Aus diesen Goofen gibt’s einmal nur Dirnen und Halunken, wenn du sie nicht besser erziehst.»
Meine Mutter flüchtete in ihre Kammer. Sie war verzweifelt. «Was mach ich denn alles falsch, o Gott? Diese schrecklichen Worte dürfen doch nicht wahr sein.» Sie sah die Bibel auf der Kommode liegen. Gibt sie mir wohl Antwort? Sie schlug sie auf und ihr Blick fiel auf das Wort: «Alle deine Kinder werden dem Herrn gebracht werden.» Ist das eine Verheissung oder eine Mahnung, dass wir Kinder immer wieder Gott hinlegen sollen? Das aufgewühlte Herz wurde langsam still und die Mutter ging wieder getrost an ihre Arbeit. Käthi hatte wohl bemerkt, dass sie zu weit gegangen war.
EXISTENZKAMPF
Unser kleiner Hof reichte nur für das Allernötigste. Das Milchgeld sank immer mehr, aber die Zinsen blieben gleich hoch. Wenn man Weizen säte, wollte ihn kein Müller kaufen mit der Begründung, der Amerikaweizen sei viel schöner. Brot konnten wir leider nicht selber backen, weil der Ofen keine Unterhitze abgab. Mit Bitten und Anhalten und weil wir gute Brotkunden waren, liess sich ein Müller doch erweichen.
Verschiedene Bauern machten Konkurs, weil sie ihre Güter in der besten Milchpreiszeit zu teuer gekauft hatten.
Einmal, als die Mutter und ich allein in der Küche arbeiteten, kam sie mir so still vor. Dann erzählte sie mir, dass sie grossen Kummer hätten, sie brächten den Zins auch nicht mehr zusammen. Letztes Jahr, als der Vater verspätet zinsen wollte, sagte der Bankverwalter, es sei schon in Ordnung gebracht worden, er dürfe ihm die Quittung überreichen. Nie erfuhren wir, wer das für uns bezahlt hatte. Wir vermuteten, der Verwalter selbst.
Die Mutter war traurig. Sie sah im Geist all die Bauern, die die Höfe verlassen mussten. Und jetzt sollten auch sie sich damit befassen. Für den Vater, der so fleissig gearbeitet hatte, wäre es furchtbar, wenn er den Hof aufgeben müsste. Ich fragte die Mutter, wann denn diese Zinserei endlich aufhören würde, einmal hat man doch fertig bezahlt. Mutter wollte es mir erklären, aber ich verstand es noch nicht.
Mit schwerem Herzen ging ich damals ins Bett, wälzte mich hin und her, sah meine kleinen Geschwister im Strassengraben liegen oder wie wir in einem leeren «Ströischüürli» Unterschlupf fänden. Endlich schlief ich ein.
Etwa vierzehn Tage später kam der Vater vom Feld zum Mittagessen und erzählte, heute sei ihm etwas Sonderbares passiert. Ein gut gekleideter Mann sei plötzlich vor ihm gestanden mit der Frage, ob er nicht Land brauchen könnte. Im Moment habe er wahrhaftig gedacht, ob dies nicht eine Engelsbotschaft sei. «Land, das wäre ja gut, aber ich kann ja auch nicht mehr zinsen, wie sollte ich da Land kaufen können?» Der Fremde sagte: «Der Fleiss entscheidet und die Mithilfe der Kinder. Über das Geld lässt sich reden.» Er verabschiedete sich mit den Worten: «Ich komme wieder.»
Der Landkauf kam mit Unterstützung durch eine Tante zustande und der vorherige Besitzer, der Konkurs gemacht hatte, musste wegziehen. Er war furchtbar wütend über uns, sagte uns Kindern und dem Vater alle Schande, wenn wir dort etwas zu tun hatten. Dieser Bauer tat uns so leid. Man erzählte, dass seine Frau das Wenige, das einging, jeweils schnell wieder forttrug.
Mehr Land erforderte auch mehr Kühe. Eines Tages stand ein Wirt und Viehhändler im Stall und sagte: «Ich bringe euch ein paar Kühe zur Probe. Wir reden dann später über Zahlungsbedingungen. Ich habe Vertrauen zu einem soliden Mann.» Meine Eltern kamen kaum aus dem Staunen heraus. Wohl gab es noch eine harte Zeit, bis alles abbezahlt war, aber nachher ging es zusehends besser.
DIE SEKUNDARSCHULE
Wir Mädchen und auch die jüngeren Brüder durften in die Sekundarschule. Das hiess, den ganzen Sommer über morgens sechs Uhr aus dem Haus. Über Mittag durften wir bei der Grossmutter Einkehr halten. Das war eine grosse Erleichterung, sonst hätten wir vier Stunden im Tag für den Weg gebraucht.
Einmal war ich spät dran und musste den halben Weg rennen. Die erste Stunde war «Singen». Da geschah es, dass ich auf einmal so grosse schwarze Flecken sah und plötzlich zwischen den Bänken auf den Boden sank. Ich erwachte erst, als ich im Gang draussen lag. Der Lehrer entschuldigte sich, er habe mich durch den halben Singsaal geschleppt in der Meinung, ich spiele Theater. Erst später habe er bemerkt, dass ich bewusstlos sei. Ich durfte mich im Physikzimmer auf einem Notbett erholen. Eine Stunde später sass ich wieder in der Schulbank.
Einmal sassen wir alle still am Aufsätze schreiben und ich kratzte mich gemächlich in meinen Haaren. Plötzlich fiel so ein kleines Ding auf das Heft. Ich wischte es sofort weg in der Angst, meine Banknachbarin könnte es sehen – aber sie war ins Schreiben vertieft. Ich wusste wohl um diese Gäste in den Haaren. Wieder zog so eine Halbzigeunerfamilie in eine Wohnung auf dem Berg und brachte der ganzen Schule diese Lauserei.
Da wir nicht immer flüssiges Geld hatten, um in der Apotheke das teure Mittel zu kaufen, versuchte es die Mutter mit Petrol. Alle fünf Mädchen mussten herhalten. Nachher band man uns die Köpfe für eine ganze Nacht mit einem Tuch gut ein. Das war ein schrecklicher Gestank in unserer Kammer. Am anderen Morgen wusch man uns die Haare gründlich mit Seifenflockenwasser. Dabei sah die Mutter, dass es meiner blonden Schwester die Haut bis weit in den Nacken hinunter geschält hatte. Aber für die Gäste im Haar war es eine Radikalkur. Auch die Nissen «klöpften» nicht mehr. Dies war die letzte Lauserei, die ich erlebte. Die Buben hatten es gut, die hat man einfach kahl geschoren.
Im Religionsunterricht hatten wir einen alten, müden Pfarrer. Die Buben ersannen stets neuen Schabernack. Einmal legten sie vorne Stinkbomben hin, ein andermal hatten sie Schnupftabak und reichten den herum. Wieder ein anderes Mal lockerten sie die Schrauben des Lehrerpults, sodass es umkippte und alle Bücher auf den Boden fielen. Nur mühsam konnte der Pfarrer die Sachen wieder aufnehmen. Dann planten sie, alle Schulbänke zusammenzuschieben, der Pfarrer brauche schliesslich nicht immer zwischen den Bankreihen durchzuspazieren. Aber jetzt müssten die Mädchen auch mitmachen. Ich war die Einzige, die protestierte und setzte mich auf die Fensterbank. Jetzt aber kamen die Buben und auch die Mädchen auf mich los. Mit den Fäusten hämmerten sie auf meinen Rücken. Mit den Händen schützte ich meinen Kopf und dachte: Nur ja keine Träne! «Heuchlerin, Spielverderberin», hörte ich sie sagen. Plötzlich ertönte der Ruf: «Der Pfarrer kommt, der Pfarrer kommt.» Alle stoben an ihre Plätze und die Bänke blieben, wo sie hingehörten. Wohl hatte ich einen siedend heissen Rücken, aber ich war glücklich dabei.
Im zweiten Jahr Sekundarschule mussten wir uns entscheiden, ob wir das dritte beziehungsweise das neunte Schuljahr noch machen wollten. Es war freiwillig. Mein innerster Wunsch seit jeher war, Lehrerin zu werden. Die Mutter wollte es mir immer ausreden, es liege finanziell niemals drin. Ich gab aber erst auf, als ein älteres Bergmädchen, das nach Aussage der Lehrer ein überdurchschnittlich intelligentes Geschöpf war, vom Seminar eine schnöde Absage bekam: Sie müssten die Stadtkinder berücksichtigen.
So wurde beschlossen, dass ich nach der Schule der Mutter zur Seite stehe, und meine ältere Schwester ging in einen fremden Haushalt.
EINE RIESIGE BELASTUNG
Sechs Geschwister vom Kindergarten- bis zum Sekundarschulalter, zwei erwachsene Brüder, die Eltern und ich waren zu versorgen. Meine Mutter besorgte die Küche, die Katzen, die Hühner und Schweine, den grossen Garten mit Pflanzblätz. Mir war das andere anvertraut: Stube und Kammern und all die viele Wäsche. Und dann ging es los: Mein erster Waschtag. In der Waschküche standen zwei riesige Behälter, der eine für weisse, der andere für farbige Wäsche. In der Ecke war ein Herd aus Stein mit einem grossen Kupferkessel darin. Eine handgetriebene Waschmaschine stand auch da. Besser war es, wenn zwei die Hebel an der Maschine auf- und abdrückten. Aber auch das Waschbrett und die Bürste mussten noch tüchtig eingesetzt werden, bis diese Wäsche sauber war.
Als ich meiner Mutter den zweiten Schub Wäsche zum Aufhängen brachte, sagte sie schmunzelnd: «Weisse Wäsche ist sicher schön, aber saubere Wäsche ist noch schöner», und führte mich an jene Leine, wo die vielen weissen Hemden hingen. Ich war ja am Lernen.
Der kleine Päuli wollte mir behilflich sein. Er wollte auch seifen. Ich hatte nur noch grosse Sachen. Da fiel mein Blick auf den Kessel mit den vielen kleinen Tüchlein. Schon zweimal waren sie vorgewaschen, und ich wollte sie nochmals einseifen und anbrühen. Ich schüttete sie ihm auf ein Brett und da seifte und seifte er, dazwischen plauderte er fröhlich und vergnügt. Auf einmal fragte er: «Für waas bruucht mer die Tüechli?» Ich erschrak ein wenig, sagte dann aber ganz einfach, grosse Mädchen und Frauen hätten oft Bauchweh und da müssten sie halt solche Tüchlein haben. Er seifte weiter.
Beim Mittagessen löffelten wir still die Suppe. Nur der kleine Päuli hielt inne und sagte: «Ich ha vil gschaffet, han ali Tüechli gsöiffet, wo di grosse Mäitli und Fraue bruuched, wenn’s Buuchwee händ.» Jetzt kicherten die grösseren Geschwister, und der Vater schmunzelte über den kleinen Knirps.
In unserem grossen Haushalt häufte sich die Flickwäsche im Sommer mächtig an. Ich hatte alle Mühe, für jedes Familienmitglied auf den Sonntag immer frische Wäsche auf die lange Bank in der Stube zu legen. Es war sicher eine strenge Zeit, aber ich durfte auch viel Schönes erleben mit meinen Geschwistern.
An Sonntagen gab es viel zu spielen. Bei Regenwetter waren wir oft in der Scheune. Mit Strohballen konnten wir Höhlen bauen und nachher Fangis machen. Bei schönem Wetter unterhielten wir uns mit verschiedenen Singspielen: «Zwibele setze», «Dreimal um den Kessel», «Im Keller muss es dunkel sein» usw. Wir hatten ja auch den Bach in der Nähe. Da stauten wir das Wasser mit Steinen und vermachten die Lücken mit Grasbüscheln. Dort lernten wir auch schwimmen. Eines half dem andern. Wir älteren Geschwister spielten oft Völkerball mit den Nachbarn. So war immer etwas los.
EIN ERSCHRECKENDES ERLEBNIS
Einer der Nachbarsburschen fiel auf einmal auf als «Mädchenjäger». Ich war ja längst nicht mehr das kleine Mädchen, deshalb hatte er es besonders auf mich abgesehen. Jeden Augenblick benutzte er, mich zu verfolgen. Ich hatte das Glück, dass ich immer Geschwister bei mir hatte. Das machte ihn ganz verrückt: «Schick mal diese Goofen weg, ich will dich endlich einmal allein haben.» Zum Baden in einem grossen Weiher mussten wir ein langes Stück durch den Wald. Plötzlich tauchte er auf, jagte meine Geschwister weg und sagte: «Aber jetzt hab ich dich.» Als ich mich verzweifelt wehrte, sagte er: «Kannst Geld dafür haben.» Wie ein gehetztes Wild rannte ich meinen verschüchterten Geschwistern nach.
Jetzt hielt ich es nicht mehr aus, meine Angst stieg ins Unermessliche. Ich hatte Angst vor mir selber, Angst vor einer Schwangerschaft. Ich entschloss mich, zu einem Seelsorger zu gehen, um meine Angst loszuwerden. Der aber beharrte darauf, dass ich ihm den Namen des Burschen nenne. Er kam aus einer angesehenen Bauernfamilie, aus der zwei Töchter schon auf guten Bauernhöfen verheiratet waren. Ich konnte mit dem besten Willen diesen Namen nicht preisgeben. Der Pfarrer wollte nicht weiter Druck auf mich ausüben und entliess mich mit dem Versprechen, wenn es wieder vorkäme, ihm den Namen zu nennen. Es sei enorm wichtig, dass jemand diesen Burschen stelle. Ich spürte, dass für mich ein Stück Jugend vorbei war.
Ruth Uebersax-Schärer
Bachgadenweiher, Badeort der Schluchtal-Kinder.