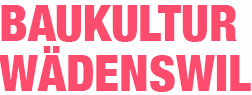Bedeutende Wädenswilerinnen
Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1991 von Marlies Bayer-Ciprian
Einleitung
Vielleicht ergeht es Ihnen zuweilen auch so wie mir beim Start zu diesem Thema? Von einem Wort hat sich eine bestimmte Vorstellung im Kopf eingenistet, lässt einen kaum mehr los; alles will unter dem einen bekannten Blickwinkel angeschaut werden. - Bedeutende Menschen zum Beispiel. Das sind doch solche, die politisch, sozial oder auch künstlerisch über ihren Tod hinaus weiterleben. Nicht nur durch ihr Werk, sondern darüber hinaus namentlich verewigt. Frauen aus den verschiedensten Zeiten, aus den unterschiedlichsten Bereichen fallen da ein. Aha, bedeutend ist gleichzusetzen mit berühmt, in meiner Vorstellung des Wortes. Ja, aber in unserer Gemeinde berühmte Frauen? Berühmte Menschen wirken doch von Weltstädten aus, haben Einfluss auf politische und gesellschaftliche Grossereignisse. Oder ist das eine Frage des Blickwinkels? Kann bedeutend auch anderes heissen? Hat der Ort, an dem wir leben, und mit ihm seine Menschen, auch Bedeutung?
Und wie! Das sollte ich erst so richtig merken, als ich mich in die verschiedenen Biographien unserer bedeutenden Frauen vertiefte. Natürlich kann es an dieser Stelle nicht darum gehen, verkannte Persönlichkeiten ans Licht zu zerren und ihnen Rechtfertigung teilwerden zu lassen. Jedoch kann das Leben und Wirken einzelner, aus einer ganzen Reihe ebenso erwähnenswerter Persönlichkeiten, ausgewählter Frauen einem neu zeigen, wie sehr es sich lohnt, den Blick in der Nähe, im eigenen Lebensraum ruhen zu lassen. Die Auswahl ist willkürlich; sie könnte mit der gleichen Berechtigung ganz anders ausgefallen sein. Dennoch steht sie unter einem Leitmotiv, einem Satz, den Frau Fanny Hauser-Schwarzenbach gesprochen hat, als ihr am 30. April 1942 das Präsidium der Kinderkrippenkommission übertragen wurde: «Wänn d Liebi zur Sach häsch, so ggraated der vill!»
Und wie! Das sollte ich erst so richtig merken, als ich mich in die verschiedenen Biographien unserer bedeutenden Frauen vertiefte. Natürlich kann es an dieser Stelle nicht darum gehen, verkannte Persönlichkeiten ans Licht zu zerren und ihnen Rechtfertigung teilwerden zu lassen. Jedoch kann das Leben und Wirken einzelner, aus einer ganzen Reihe ebenso erwähnenswerter Persönlichkeiten, ausgewählter Frauen einem neu zeigen, wie sehr es sich lohnt, den Blick in der Nähe, im eigenen Lebensraum ruhen zu lassen. Die Auswahl ist willkürlich; sie könnte mit der gleichen Berechtigung ganz anders ausgefallen sein. Dennoch steht sie unter einem Leitmotiv, einem Satz, den Frau Fanny Hauser-Schwarzenbach gesprochen hat, als ihr am 30. April 1942 das Präsidium der Kinderkrippenkommission übertragen wurde: «Wänn d Liebi zur Sach häsch, so ggraated der vill!»
Susanna Hauser-Wüest; 1725−1787, Vordere Fuhr
Im Jahrbuch 1988 wurde ausführlich von Susanna Hausers Leben und Wohnort berichtet, dennoch möchte ich unter oben erwähntem Leitsatz noch einmal auf sie zu sprechen kommen. Als sie 1773 auf die Vordere Fuhr zu wohnen kam, waren zwölf ihrer dreizehn Kinder bereits auf der Welt, ihr jüngstes im Alter von vierzehn Jahren. Aus der in Küsnacht verbrachten Jugendzeit ist nichts Erwähnenswertes bekannt. Hingegen weiss man, dass sie noch im Alter von 59 Jahren einem Nesthäkchen das Leben schenkte. Dreizehnmal hat sie eine Geburt erlebt und erlitten. Zweimal auch die Erfahrung des frühen Todes ihrer Kinder gemacht. Ob sie dabei traurig war? Schicksalsergeben? Aus dem Zürcher Oberland liest man von einer Mutter: «Eis mues gaa, das git es Ängeli mee im Himmel! Übers Jahr chunnt wider es anders.» Nein, mit Mangel an Mutterliebe hat dies nichts gemein. Was hätte man auch tun wollen? So ganz der unsrigen entsprach die damalige medizinische Versorgung nicht, zudem war es auf dem Land auch nicht der Brauch, soviel zu doktern. Im Tagebuch einer Berner Mutter aus dem Jahr 1831 liest man, wie die junge Frau schreibend mit dem Tode ihres dreijährigen Bübchens fertigzuwerden versucht. Wie Frau Hauser-Wüest das verwindet, was sie sonst denkt, erlebt, fühlt, ist nirgends vermerkt. Sie ist aber eine der ersten Oberschichtfrauen in Wädenswil, welche man porträtiert findet.
Susanna Hauser-Wüest, 1725−1787, Ölgemälde in Privatbesitz.
Das Ölgemälde, welches sie zeigt, ist kürzlich sogar restauriert worden. Jemand also hat diese Frau damals schon für so bedeutend angeschaut, dass er der Nachwelt ihr Bild erhalten und weitergeben wollte.
SUSANNA Hotz, 1720−1796, BOLLER
Etwas vor Frau Hauser-Wüest zur Welt gekommen und auch älter geworden, ist Frau Susanna Hotz. Beide Leben haben je einen ganz anderen Verlauf genommen, jedenfalls in den äusseren, vergleichbaren Teilen. Ob Frau Hotz auch Schwestern gehabt hat, entzieht sich meiner Kenntnis; drei Brüder aber, welche alle denselben Beruf ergriffen haben wie ihr Vater, drei Chirurgen nämlich, sind erwähnt. Sie selbst ist Tochter aus dritter Ehe ihres Vaters mit Barbara Haab. Bei ihrer Geburt war der Vater bereits 67, die Mutter 41 Jahre alt. Immerhin durfte er noch weitere zwölf Jahre der Familie vorstehen, bevor seine Tochter Halbwaise wurde. Offenbar hat die Chirurgenfamilie Susanna so stark beeinflusst, dass sie mit 22 auch wieder einen Chirurgen heiratete. Oder haben die Brüder die Verbindung arrangiert? Liebe war damals nicht der Hauptbeweggrund zu einer Hochzeit; es gab andere, ebenso wichtige Faktoren.
Nachdem sie also ihre ganze Jugend in Wädenswil, vermutlich auf dem Boiler, wo ihr Vater seine Chirurgenpraxis führte, verbracht hatte, kam sie nun durch ihre Ehe mit dem Chirurgen Johann Baptist Pestalozzi nach Zürich, Stadtbürgerin geworden. Ein Mitarbeiter ihres Mannes berichtet aber, dass ihr in der neuen Umgebung nie recht wohl geworden sei. Man habe sie ausgiebig spüren lassen, dass sie vom Land sei, nicht in die Stadt gehöre. Immer wieder gaben Susannas ländliche Abkunft und ländliche Manieren Gelegenheit zu Spott. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie aus Anlass des Todes ihres Mannes mit 31 als Witwe wieder nach Wädenswil zurückgekommen ist. Bei Verwandten und Bekannten in Wädenswil und Richterswil fand sie mit ihrem vierjährigen Söhnchen, Johann Heinrich Pestalozzi, gute Aufnahme. Auch später hat Pestalozzi immer wieder seine Mutter und seine Verwandten, insbesondere einen Onkel, besucht. Es haben sich auch alle stark für seine manchmal ausgesprochen grossen Pläne eingesetzt und sie gefördert. So stammt also Susanna Hotz einerseits aus einer weitherum berühmten Chirurgenfamilie, ihr Vater war sogar in zweiter Ehe mit der Tochter des Landvogtes, mit Anna Esther Escher, verheiratet; andererseits wirkt sie durch ihren bedeutenden Sohn Johann Heinrich Pestalozzi auf eine Art weiter, die einen hoffen lässt, Susanna würde heute nicht mehr verspottet und verlacht wegen ihrer ländlichen Abkunft.
Heinrich Pestalozzi, 1746−1827, Sohn von Susanna Pestalozzi-Hotz.
Denn dass man nicht nur den Kopf, sondern auch das Gemüt des Menschen erziehen soll, versuchte ihr Sohn doch an uns weiterzugeben. Vielleicht, weil ihm seine Mutter aus ihren Erfahrungen aufs lebendigste zu berichten wusste?
Milly Ganz, 1882−1969, Alte Kanzlei und Eidmattstrasse
Beinahe hundert Jahre nach dem Tode von Susanna Hauser-Wüest ist jemand zur Welt gekommen, der für unser Dorf eine ganz andere Rolle spielt: Milly Ganz. Als jüngste Tochter eines Arztes in Wädenswil und einer musikalisch interessierten Mutter ist nach drei älteren Brüdern am 20. März 1882 Emilie geboren worden. Man nennt sie Milly. Die ganze Familie hat in ihrer Jugendzeit oft selber Theaterstücke verfasst, einstudiert und aufgeführt. Die Kinder durften den Vater während ihrer Ferien auf seine Visiten begleiten. So haben sie den Wädenswiler Berg, besondere Weglein dorthin, immer neue Blumen und Tiere kennengelernt. Der Vater nahm sich viel Zeit, seine Kinder all die verborgenen Naturschönheiten entdecken zu lassen. Millys Geburtshaus ist die Alte Kanzlei, Ecke Zugerstrasse/Glärnischstrasse. Vis-a-vis vom damaligen Postgebäude, im Haus Merkur, führte der Vater später seine Praxis. Er war nicht nur Landarzt, sondern auch Asylarzt und Bezirksarzt. So sind seine und die Lebensdaten seiner Angehörigen gut zugänglich.
Milly Ganz war eine recht erfolgreiche Schriftstellerin, welche bis zu ihrem Tode im Jahr 1969 acht zum Teil mehrfach aufgelegte Romane herausgegeben hat.
Milly Ganz war eine recht erfolgreiche Schriftstellerin, welche bis zu ihrem Tode im Jahr 1969 acht zum Teil mehrfach aufgelegte Romane herausgegeben hat.
Milly Ganz, 1882−1969.
Allerdings hatte sie, ausser in den Familienstücken, in ihrer Jugend keine Gelegenheit, schriftstellerische Erfahrungen zu sammeln. Erst 1943, im Alter von 61 Jahren, ist ihr erster Roman herausgekommen. Bereits hatte sie ein sehr bewegtes Leben hinter sich, in Italien und den USA; mit vielen familiären Sorgen, finanziellen Nöten. Gerade dieses erste Buch aber betrifft Wädenswil. «Der Narr seines Herzens» beschreibt ihre Jugendzeit, die Arbeit ihres Vaters, seine Erfolge und Misserfolge. Mit Liebe berichtet sie auch über ihre Mutter, ihre Haushälterin, welche beinahe zur Familie gehört. Lässt aber auch den Verzicht nicht aus, den die ganze Familie leisten musste, weil der Vater mit Zeit und Geld vollkommen für seine Patienten zur Verfügung stand. Auch der letzte Roman, «Alle Herrlichkeit des Herzens», den Milly im Alter von 80 Jahren schrieb, betrifft wiederum unsere Gemeinde, als Fortsetzung des ersten. Manchmal schildert die Schriftstellerin das dörfliche Leben als beengend, bedrückend, dann wieder als schillernd, lebendig, in den herrlichsten Farben der Jugendfreude. In jedem Falle aber ist nicht nur Frau Ganz für Wädenswil bedeutend, sondern Wädenswil war es auch für sie.
Elisabeth Weber-Hauser, 1842−1906, Brauerei Wädenswil
Gehen wir vom Erscheinungsdatum des «Narr seines Herzens» rund hundert Jahre zurück, kommen wir bei der Geburt einer Frau an, welche in diesem von Milly Ganz als beengend und kleinlich geschilderten Milieu erfolgreich geschäftlich gewirkt hat: Elisabeth Weber-Hauser, Tochter von Statthalter Hauser. Im Alter von 21 Jahren (das richtige Heiratsalter in Wädenswil: Frau Ganz: 21, Frau Hotz: knapp 22) heiratete sie den um 15 Jahre älteren Michael Weber, Brauer und psychologisch versierter Arbeitgeber in der damaligen Brauerei Wädenswil. Eine verständnisvolle, liebe Ehegattin sei sie gewesen, habe den grossen Haushalt liebevoll geführt, die Angestellten und Arbeiter am Familientisch fürsorglich verpflegt. Zudem hat sie genau gewusst, was sie wollte, interessierte sich fürs Geschäft, waltete zu Hause sparsam und hielt auf gute Ordnung. Drei Kinder entsprossen dieser Ehe: die beiden Söhne Franz und Fritz sowie die Tochter Elise. Das Familienleben sei glücklich gewesen. Man habe Wert auf Zucht und Ordnung gelegt, welche aber gewärmt wurden durch grosse väterliche und mütterliche Liebe und Güte.
Nicht nur vom Geschäftsleben erfahren wir. Es ist offenbar auch wichtig und erwähnenswert, dass man zwar nach alter Väter Sitte Strenge walten lässt, aber ohne Liebe geht nichts.
Nicht nur vom Geschäftsleben erfahren wir. Es ist offenbar auch wichtig und erwähnenswert, dass man zwar nach alter Väter Sitte Strenge walten lässt, aber ohne Liebe geht nichts.
Elisabeth Weber-Hauser, 1842−1906.
Als ob Pestalozzi schon richtig starke Wirkung entfaltet hätte! Diese Frau wird ganz lebendig; sie ist streng und korrekt: «Da git's kei Bire!» -«Du bisch pünktlich!» - «Du weisch, was z tue häsch!» - «Wer nöd wott, häd ghaa!». Aber wer Trost braucht, läuft zu ihr; sie ist immer für einen da. - Und für sich? Daran auch noch zu denken, blieb keine Zeit. Zudem war es nicht Mode. Wie die oben erwähnte Berner Mutter 1835 in ihr Erziehungstagebuch notiert: « ... eine weibliche Seele muss früh lernen, sich selber als fast gar nichts zu betrachten.»
Mit 43 hat Elise Weber ihren erst 58jährigen Mann bereits verloren. Mitten in einer Phase von Neuorientierung und technischer Änderungen, mitten in einem grossen Brauerei-Konkurrenzkampf starb Michael Weber. Nun zeigte sich der Wert von Elises geschäftlichem Interesse! Keinen einzigen Gedanken verschwendete sie an einen möglichen Verkauf der Firma, um sich selber mit dem Erlös eine trostreiche Zeit zu verschaffen. Sie würde das Geschäft selbst weiterführen! Als Blaustrumpf in einer Männergesellschaft? Endlich eine Karriere vor sich? Endlich nicht mehr ausschliesslich den Haushalt vor sich? Mitnichten! Für ihre beiden Söhne hat sie das Heft in die Hand genommen. Bei deren Mündigkeit wollte sie ihnen das Brauereiunternehmen so übergeben, wie es im Sinne ihres Mannes gewesen wäre. Trotz grosser Unterstützung ihres nachmaligen Schwiegersohnes und damaligen Braumeisters sowie des Vormundes ihrer Söhne erlebte sie eine harte Zeit, mit persönlichen Bittgängen zu ihren Kunden, damit diese nur ja weiter das Bier bei ihnen beziehen würden. Hat sich der Einsatz aus heutiger Sicht gelohnt? Müssige Frage! Frau Weber lebte damals, musste damals handeln und entscheiden. Der Familie das Geschäft zu erhalten, stand zu jener Zeit allgemein an erster Stelle. Mit Liebe zur Sache und zu den Söhnen. Und mit Liebe zum verstorbenen Gatten, dem sie sich ja mit ihrer Arbeit auch nahefühlen durfte. Beide Söhne haben später Frauen geheiratet, welche wiederum mit zwei weiteren bedeutenden Wädenswilerinnen verwandt waren: Fritz Weber war der Schwager von Thekla Lehnert, Franz Weber der Schwiegersohn der Bundesratsgattin Sophie Hauser-Wiedemann.
Mit 43 hat Elise Weber ihren erst 58jährigen Mann bereits verloren. Mitten in einer Phase von Neuorientierung und technischer Änderungen, mitten in einem grossen Brauerei-Konkurrenzkampf starb Michael Weber. Nun zeigte sich der Wert von Elises geschäftlichem Interesse! Keinen einzigen Gedanken verschwendete sie an einen möglichen Verkauf der Firma, um sich selber mit dem Erlös eine trostreiche Zeit zu verschaffen. Sie würde das Geschäft selbst weiterführen! Als Blaustrumpf in einer Männergesellschaft? Endlich eine Karriere vor sich? Endlich nicht mehr ausschliesslich den Haushalt vor sich? Mitnichten! Für ihre beiden Söhne hat sie das Heft in die Hand genommen. Bei deren Mündigkeit wollte sie ihnen das Brauereiunternehmen so übergeben, wie es im Sinne ihres Mannes gewesen wäre. Trotz grosser Unterstützung ihres nachmaligen Schwiegersohnes und damaligen Braumeisters sowie des Vormundes ihrer Söhne erlebte sie eine harte Zeit, mit persönlichen Bittgängen zu ihren Kunden, damit diese nur ja weiter das Bier bei ihnen beziehen würden. Hat sich der Einsatz aus heutiger Sicht gelohnt? Müssige Frage! Frau Weber lebte damals, musste damals handeln und entscheiden. Der Familie das Geschäft zu erhalten, stand zu jener Zeit allgemein an erster Stelle. Mit Liebe zur Sache und zu den Söhnen. Und mit Liebe zum verstorbenen Gatten, dem sie sich ja mit ihrer Arbeit auch nahefühlen durfte. Beide Söhne haben später Frauen geheiratet, welche wiederum mit zwei weiteren bedeutenden Wädenswilerinnen verwandt waren: Fritz Weber war der Schwager von Thekla Lehnert, Franz Weber der Schwiegersohn der Bundesratsgattin Sophie Hauser-Wiedemann.
Elisabeth Rellstab, 1843−1904, Im Unteren Lehmhof
Eine Zeitgenossin von Elisabeth Weber-Hauser ist Elise Rellstab, welche 1843 auf dem Unteren Lehmhof geboren wurde. Sie erlebte auf dem elterlichen Hof eine glückliche Kindheit. Ihr Vater war Landwirt, Gemeindepräsident und Scharfschützenhauptmann. In der Schule zeichnete sich Elise durch Begabung und Fleiss aus. Gerne hätte sie eine höhere Schule besucht, was ihr aber nicht ermöglicht wurde. Sie musste der kränklichen Mutter bei der Führung des Haushaltes auf dem Hof beistehen. Ihr Lerneifer aber war so gross, dass sie sich immer ein Viertelstündchen in einer stillen Ecke zu gönnen wusste, um sich dem Selbststudium fremder Sprachen zu widmen. Weil die Arbeit auf dem Hof nie unter diesen Studien zu leiden hatte, durfte sie 1863, zu ihrem zwanzigsten Geburtstag, nach Frankreich reisen. In der Champagne wurde sie von Ihrem Grossonkel Johannes Rellstab beherbergt, damit sie an Ort und Stelle ihr Französisch verbessern konnte und Erholung von ihren Pflichten bekam.
Das eigentliche Entscheidungsjahr aber wurde 1870, der Beginn des Deutsch-Französischen Krieges. Als Nachrichten nach Wädenswil kamen, dass die Preussen gegen das Gut ihres Grossonkels stiessen, reiste sie auf der Stelle auf eigene Faust über Genf nach Monneaux, um ihrem Onkel beizustehen.
Elisabeth Rellstab, 1843−1904.
Daraus wurde erst einmal nichts, denn sie bedurfte selber der Pflege, da sie mit hohem Fieber ankam. Kaum genesen, begann sie im Dorf den deutschen Soldaten im Lazarett auf die verschiedenste Weise beizustehen: tröstete, verband Wunden, vermittelte Nachrichten an die Angehörigen, versuchte die überarbeiteten Lazarettdiener zu entlasten. Vieles belastete sie bei dieser Arbeit. All die Leiden der Soldaten, der Platzmangel, die fehlende medizinische Ausrüstung, die schrecklichen Ausdünstungen. Daneben wurde es ihr schwer angekreidet, dass sie Arbeit tat, die sich für eine Bürgerstochter nicht gehörte, noch dazu für eine unverheiratete. Wenn es wenigstens französische Soldaten gewesen wären. Nächstenliebe ist gut und recht, aber bitte am richtigen Ort! Nach langen Strapazen meldete sich ihr eigener Körper mit Fieber und Kopfschmerzen. Sie war gezwungen, nach Hause zu fahren.
Aber ihre Berufung hatte sie gespürt. In ihrer Heimatgemeinde setzte sie sich dafür ein, dass ärmere Kranke eine Krankenanstalt hätten, wo man sich um sie kümmern und sie pflegen konnte. Im Armenhaus am Plätzli schlug man ein paar Betten zu diesem Zweck auf. Bei ihrem Werk halfen ihr manche Frauen, die auch in anderen Belangen wieder mit Hand anlegten, teils mit Geld, teils mit Arbeit oder gar mit beidem. Ob diese Berufung, den kranken, bedürftigen Menschen beizustehen, der alten Berufung ebenbürtig war? Ob ihr Werk sie genauso glücklich gemacht hat, wie eine höhere Schulbildung sie hätte machen können? Wir jedenfalls verdanken ihr die Gründung des Krankenasyls.
Anna Schnyder-Blattmann, 1844−1924, zum Morgenstern
Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts, als sich Pestalozzis Ideen, aber genauso andere, sozial ausgerichtete Vorstellungen in höheren Kreisen langsam, aber sicher Gehör zu verschaffen begannen, haben immer wieder vor allem Frauen der ganzen Sache eine praktische Richtung geben können. Wenn jedenfalls ein Herr Engels in den englischen Industriestädten mit Entsetzen vom grossen Arbeiterelend Kenntnis nahm, so hatte davon noch lange niemand gegessen! Frauen, Bürgersfrauen, Fabrikantengattinnen kannten solches Leben aus ihrem persönlichen Kontakt mit den Arbeiterfrauen. Beim Überreichen der Weihnachtsgaben, bei Krankenbesuchen lernten diese Frauen die engen Löcher kennen, mit ihrer ungenügenden Heizung, ihrer Dürftigkeit, ihren muffigen Gerüchen. Sie wussten, worum es ging. Windeln, abgetragene Kleidung, Obst, Gemüse! Erst einmal wird geschenkt! Leider wird mit solcher Freude auch immer Eifersucht und Neid geschenkt. Ja, wer hat die Gaben nötiger? Familie Huber mit fünf Kindern oder Witwe Hügli, die zwar nur zwei Kinder, dafür aber eben keinen Mann mehr hat, der mitverdienen könnte? Wer entscheidet? Zudem sind ja mit solchen Gaben die kleinen Kinder der Familien noch lange nicht betreut! Dieser Aufgabe haben sich hier bei uns einige Frauen miteinander angenommen.
Anna Schnyder-Blattmann, 1844−1924.
Damit wollten sie zweierlei erreichen: Die Kleinen sollten während des Tages, während der Fabrikarbeit ihrer Eltern, in guter Obhut betreut werden. Immerhin sind sie die Zukunft jeder Gemeinde. Zudem sollte aber auch all den gezwungenermassen berufstätigen Müttern die dauernde Sorge um Aufsicht und Betreuung ihrer Kleinsten abgenommen werden, ihnen vielleicht auch das immer vorhandene schlechte Gewissen erleichtert werden, das eine Mutter eben doch stets plagt, wenn sie genau weiss, dass zu Hause ein Kleines wartet, das sie brauchte, aber auch die übrige Familie auf ihren kleinen und doch so wichtigen Verdienst angewiesen ist. Wie manche dieser Frauen versuchte durch Putzarbeiten in vornehmen Häusern nach der Fabrikarbeit das Familienbudget nochmals ein wenig aufzustocken! Die Voraussetzungen zur ersten Idee der Einrichtung einer öffentlichen Kinderkrippe waren zur Genüge gegeben. Säuglinge im Alter von sechs (!) Wochen und Kleinkinder bis zu vier Jahren sollten Aufnahme und Betreuung finden.
Bald wurde das Grüpplein dieser Idealistinnen von weiteren Kreisen unterstützt. Unter dem Präsidium von Fanny Steinfels-Stäubli standen nebst vielen weiteren Frauen wiederum Elise Rellstab zur Verfügung, wie auch eine Nichte Johanna Spyris, Meta Regina Gessner-Heusser, deren Mann die Villa im Rosenmattpark erbauen liess. Die vierzig Rappen Kosten pro Kind und Tag wurden täglich für den entsprechenden Betreuungstag mitgebracht. Der kleine Pflegling wurde dafür umfassend umsorgt: Vom Waschen, Kämmen über frische Kleidung bis zu den regelmässigen Mahlzeiten und Spaziergängen stand alles für die Kleinen zur Verfügung. Um 1900 wurden 26 Kinder betreut. Nachdem die Kinderkrippe zunächst an der Stegstrasse in von der Familie Gessner-Heusser zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten untergebracht war, hätte sie schon bald einmal für 40 Kinder Platz bieten sollen. Leider hatte der Vorstand des Vereins nicht die Möglichkeit, sich nach einer neuen Liegenschaft umzusehen: eigene Mittel zum Bau oder Kauf eines passenden Gebäudes waren einfach nicht vorhanden. Wie auch? Das Essen, die Kinderkleidchen, Betreuung, Heizung im Winter, all das war mit Kosten verbunden. Von den Eltern durfte man wirklich nur gerade den allernötigsten Beitrag erheben, damit diese Einrichtung zugunsten der Arbeiterfrauen nicht ihren Zweck verfehlte!
Im Vorstand allerdings befand sich auch Frau Anna Schnyder-Blattmann, aus dem Haus Morgenstern an der Luftstrasse. Ihr Mann hat aus der Rosshaarspinnerei an der Luftstrasse eine grössere Fabrik an der Einsiedlerstrasse aufgebaut, die heutige Bettzeugfabrik J. Schnyder AG. Diese Frau nun hat die Initiative ergriffen und gegenüber der Katholischen Kirche an der Etzelstrasse ein neues Krippenhaus bauen lassen. Für nur drei Prozent Zins überliess sie sodann dieses Gebäude dem Krippenverein. Für die Inneneinrichtung kam Geld anlässlich einer Kinder-Theater-Aufführung zusammen. Dieses 1906 bezogene Haus, das nun Platz für alle angemeldeten Kinder bot, konnte der Krippenverein 1911 zu einem stark reduzierten Preis käuflich erwerben.
Im Vorstand allerdings befand sich auch Frau Anna Schnyder-Blattmann, aus dem Haus Morgenstern an der Luftstrasse. Ihr Mann hat aus der Rosshaarspinnerei an der Luftstrasse eine grössere Fabrik an der Einsiedlerstrasse aufgebaut, die heutige Bettzeugfabrik J. Schnyder AG. Diese Frau nun hat die Initiative ergriffen und gegenüber der Katholischen Kirche an der Etzelstrasse ein neues Krippenhaus bauen lassen. Für nur drei Prozent Zins überliess sie sodann dieses Gebäude dem Krippenverein. Für die Inneneinrichtung kam Geld anlässlich einer Kinder-Theater-Aufführung zusammen. Dieses 1906 bezogene Haus, das nun Platz für alle angemeldeten Kinder bot, konnte der Krippenverein 1911 zu einem stark reduzierten Preis käuflich erwerben.
Kinderkrippe an der Stegstrasse in Wädenswil, eröffnet 1898.
FANNY FLECKENSTEIN, 1861−1904
Von doppelter Seite kannte auch Fanny Fleckenstein die Sorgen und Nöte der Arbeiterfrauen. Erstens als Tochter aus einer Fabrikantenfamilie: ihrem Onkel gehörte die obere Tuchfabrik am Reidbach, der Vater war «Fabrikant am See». Zweitens war sie seit 1892 Elementarlehrerin in Wädenswil. In dieser Funktion musste auch sie miterleben, wie ihre Schützlinge viel zuwenig gut betreut werden konnten. Wann hätte die Fabrikarbeiterin noch Zeit gefunden, die Kleider anständig zu flicken, die Kinder sauber zu halten, ihnen abwechslungsreiche Nahrung zu geben? Wo hätte sie es lernen sollen?
Im Herbst 1900 war der Beschluss gefasst: Diesem Mißstand muss man abhelfen! Fanny Fleckenstein gründet eine Fortbildungsschule, welche an Abendkursen den jungen Arbeiterfrauen und -mädchen «Praktische Wissenschaften» vermitteln soll. Selbständig geht sie den Erziehungsrat um Unterstützung an und erreicht so, dass ein «Verein zur Förderung weiblicher Fortbildung» gegründet wird. Mit Hilfe der bereits oben genannten Frauen, Frau Pfarrer Emmy Schreiber-Kunz, der Handarbeitslehrerin Emma Rusterholz und weiterer Mitglieder wird unter dem Präsidium von Pfarrer Jakob Pfister die Ausbildung in Gesundheitspflege, Erziehung, Flicken, Nähen, Putzen und Kochen in Angriff genommen.
Fanny Fleckenstein, 1861−1904.
Zudem sollen auch die volkstümlichen Erzählungen wieder bekanntgemacht werden. Die praktischen Kochkurse im nicht mehr verwendeten Schützenhaus auf der Fuhr, an der Stelle des heutigen Oberstufenschulhauses, können von 1902 an angeboten werden. Herr Pfarrer Pfister befürwortet diese Kurse sehr, denn er glaubt, dass die Männer ihr Geld nur im Wirtshaus vertrinken, weil ihr Zuhause nicht anheimelnd und das Essen schlecht ist. In diesem Punkt durfte offenbar damals die Frau die Verantwortung für das Handeln des Mannes tragen! Noch diverse Neuerungen durfte die «Mutter» des Vereins mittragen, bevor sie 1904 starb. Eine Namensänderung hat dieser Verein seit damals auch erlebt; er heisst nun «Frauenverein».
Sophie Hauser-Wiedemann, 1845−1931
Ob Sie folgende Frau kennen, ist nicht so ganz sicher, bestimmt aber dem Namen nach ihren Mann. Auch sein Gesicht ist Ihnen vielleicht bei einem Spaziergang durch den Rosenmattpark schon begegnet, zwar aus Stein gehauen, dafür bei jedem Wetter anwesend: Bundesrat Walther Hauser. Diese Eheleute waren die Schwiegereltern des einen Sohnes der Elisabeth Weber-Hauser, des Franz Weber, welcher bereits 1923 verstorben ist.
Diese Frau nun ist Sophie Hauser-Wiedemann, Frau Bundesrat, wie sie in der Trauerrede von Pfarrer Ryser in Zürich genannt wird. Auch sie ist Zeitgenossin einiger der ausgewählten Frauen. Ihr Leben sei reich gewesen, reich nicht nur an Jahren, sondern vor allem an Inhalt. Sogar Urenkel durfte sie erleben. Reichtum nicht nur an Glück, sondern auch an Unglück. Das Schöne sei vorweggenommen: Das Elternhaus sei schön gewesen, die Ehe glücklich, die Kinder lieb, ihre Stellung in der Gesellschaft angenehm, der Lebensabend lang und friedlich.
Diese Frau nun ist Sophie Hauser-Wiedemann, Frau Bundesrat, wie sie in der Trauerrede von Pfarrer Ryser in Zürich genannt wird. Auch sie ist Zeitgenossin einiger der ausgewählten Frauen. Ihr Leben sei reich gewesen, reich nicht nur an Jahren, sondern vor allem an Inhalt. Sogar Urenkel durfte sie erleben. Reichtum nicht nur an Glück, sondern auch an Unglück. Das Schöne sei vorweggenommen: Das Elternhaus sei schön gewesen, die Ehe glücklich, die Kinder lieb, ihre Stellung in der Gesellschaft angenehm, der Lebensabend lang und friedlich.
Aus ihrer Jugend ist bekannt, dass noch neun Geschwister da waren, dass die Jugend ungetrübt war. Was dies heissen mag? Materielles Glück? Dass Sophie trotz neun Geschwistern nie Hunger und Not leiden musste? Oder dass sie in Angriff nehmen durfte, was ihr gefiel? Oder dass sie als ältere Schwester den Kleineren eine Zusatzmutter sein durfte? Natürlich wird darüber nichts ausgesagt. Solange nichts Verbrecherisches, Hirnverbranntes oder sonst Neumodisches geschieht, braucht man aus der Jugend (auch aus der Jugend bedeutender Männer) nichts zu berichten. Eine Jugend haben ja alle hinter sich. Wir wissen schliesslich alle ganz genau, was eine ungetrübte Jugend zu sein hat!
Die Krönung dieser herrlichen Zeit nun bedeutete die Hochzeit. Als Zwanzigjährige ging Sophie die Ehe mit dem Herrlichsten ein. Ihr Mann, der spätere Bundesrat, war nur gerade acht Jahre älter als sie. Immer noch weiter sei Sophies Glückssonne gestiegen: fünf Töchtern durfte sie das Leben schenken. Die Liebe ihrer Kinder, des Ehegatten und all dessen Ehren hätten Sophie umgeben und auf sie abgefärbt. Das wohl als Trost dafür, dass sie 1888 von Wädenswil weg nach Bern umziehen musste, herausgerissen aus ihrem vertrauten Familien- und Bekanntenkreis, mit 43 Jahren, im Alter, da Elisabeth Weber eben selbständig die Brauerei führen musste? Die Ehren, welche ihrem Gatten zuteil wurden, hätten auf Sophie zurückgestrahlt.
Satz um Satz wird ihr Glück mit der Würde anderer Menschen gleichgesetzt. Wenn man nun fragte, ob sie selbst dies alles auch als Glück empfunden hat? Fünf Töchter grosszuziehen, während der Vater dauernd politisch überbeschäftigt war, dürfte auch damals nicht immer ganz leicht gefallen sein. Sich immer und immer mit des Mannes Interessen auseinanderzusetzen, ohne je Zeit und Gelegenheit zu haben, sich auf eigene Wünsche und Hoffnungen zu besinnen, mag ja tatsächlich üblich gewesen sein. Ob es deswegen einfacher war?
Oh, sicher, die Liebe entschädigt für vieles, was eine Frau allenfalls für sich selbst je erhofft hätte. Sie wäre aber vielleicht noch glücklicher, noch lebendiger geworden, wenn eine Gattin eigene Kraft, eigene Stärke, eigene Ideen hätte einbringen können und wollen. Im ganzen Nachruf jedoch wird Sophie ausschliesslich in Bezug auf andere Menschen definiert, ihr Glück an dem anderer Menschen beschrieben. Sie kommt eigentlich nur durch andere überhaupt zu Worte.
Ob eine Jugend wirklich so ungetrübt ist, wenn ein Mädchen mit elf Jahren die Mutter und mit sechzehn auch den Vater verliert? Ob nicht hier bereits der Grundstein dazu gelegt wurde, ein Leben nur für andere führen zu wollen? Ohne je nach sich selber zu fragen?
Ob eine Jugend wirklich so ungetrübt ist, wenn ein Mädchen mit elf Jahren die Mutter und mit sechzehn auch den Vater verliert? Ob nicht hier bereits der Grundstein dazu gelegt wurde, ein Leben nur für andere führen zu wollen? Ohne je nach sich selber zu fragen?
Bundesrat Walther Hauser, 1837−1902.
Zuerst den Geschwistern alles abnehmen, später für Mann und Töchter leben, ohne Abstand für Enkel und Urenkel dasein. Für Bundesrat Hauser und ihre Töchter war Sophie die denkbar idealste Frau und Mutter. Wer aber hätte - nicht in materiellem Sinne - für sie sich gesorgt?
«Sie war eine Mutter» - so der Pfarrer am Ende seiner Trauerrede -, « ... eine Gattin, eine Mutter, ein Born unerschöpflicher Liebe, so reich im Tragen, im Dulden, im Geben, im Vergeben! ... Da wachsen in der Seele Knospen, die ohne das Messer des Gärtners tot geblieben wären, jetzt aber tragen sie Blüten und reiche Früchte.»
Dies mag ja tatsächlich dem Empfinden der Hinterbliebenen entsprechen, Ausdruck ihrer Wertschätzung für die Verstorbene sein, dass man aber mit solcher Inbrunst diese Hingabe an Familie und Verwandte indirekt von der Hälfte der Menschheit aufgrund ihres Geschlechtes fordert, ist denn doch etwas stark.
Dies mag ja tatsächlich dem Empfinden der Hinterbliebenen entsprechen, Ausdruck ihrer Wertschätzung für die Verstorbene sein, dass man aber mit solcher Inbrunst diese Hingabe an Familie und Verwandte indirekt von der Hälfte der Menschheit aufgrund ihres Geschlechtes fordert, ist denn doch etwas stark.
Fanny Moser-Sulzer Von Warth, 1848−1925, Schlossgut Au
Auch in die andere Richtung lässt sich's übertreiben! Diese Seite zeigt sich an einer Frau, welche nicht eigentlich eine Wädenswilerin ist, dennoch aber sehr bedeutend für uns. Über ihre Person, ihre Lebenseinstellung ist zur Hauptsache durch ihre beiden Töchter berichtet worden. Beide sind sie in die sogenannten «Schaffhauser Biographien» mit längeren Berichten aufgenommen, einerseits, weil sie aus einer für Schaffhausen bedeutenden Familie stammten, andererseits, weil sie nicht nur als Töchter erwähnenswert sind, sondern als eigenständige Persönlichkeiten. Diese Frau ist Fanny Moser-Sulzer von Warth. Auffallend in ihrem Lebenslauf sind besonders zwei Sachen: erstens ihr immenses Bedürfnis nach Macht und Anerkennung; zweitens die grundverschiedenen Ansichten, welche über sie herrschen, je nachdem, ob Aussenstehende sie würdigen oder Familienangehörige. Für Wädenswil ist sie bedeutend als diejenige Frau, welche 1887 das ehemalige Werdmüllergut auf der Halbinsel Au gekauft hatte. Ihr Haus hatte immer offene Türen für Künstler und Wissenschafter. Berühmte Namen wie Heim - Herr und Frau -, Forel, Meyer, Freud, Heer, Angst und viele mehr finden sich im Gästebuch. Als sporadische oder dauernde Gäste hielten sich deren Träger dort auf.
Fanny Moser-Sulzer von Warth, 1848−1925.
Doktor Heim gilt als bedeutender Geologe, klärte eben die Ergiebigkeit der Kohlenader in Käpfnach ab. Seine Frau praktizierte als erste Schweizer Ärztin. C.F. Meyer wurde dort zum «Schuss von der Kanzel» inspiriert, Sigmund Freud kümmerte sich um Frau Mosers Gemütszustand. Harry Angst war bekannt als Begründer des Schweizerischen Landesmuseums und Auguste Forel als Leiter der Psychiatrischen Klinik Burghölzli sowie als militanter Bekämpfer des Alkoholmissbrauchs. Für eine Gemeinde, wie Milly Ganz sie schildert, vielleicht ohnehin für jede Gemeinde, bedeutet es eine besondere Ehre, solch illustre Gäste zu beherbergen. Diese Ehre wiederum, fiel auch auf Frau Moser zurück, da sie solches durch ihre Gastfreundschaft erst ermöglichte. Auf mancherlei Arten verstand sie es, Bekanntschaft mit solchen Menschen zu machen, ihnen ihr Mentona Moser, 1874-1971.
Heim als Ort der Schaffenskraft, der Regsamkeit geistigen Lebens zu offerieren. Damit und mit ihren vielen Reisen versuchte sie sich dafür zu entschädigen, dass es ihr nie gelang, Zugang zu den europäischen Fürstenhöfen zu erhalten. Auch ihre Töchter zeigten nicht im geringsten Anstalten dazu, ihrer Mutter durch standesgemässe Heirat das gefühlsmässige Los etwas zu erleichtern. Doch lassen Sie mich vorne beginnen: Fanny Moser-Sulzer von Warth stammt aus einer angesehenen Winterthurer Familie. Ihr Vater leitete den Fürstlich-Bayrischen Zuckerhandel, war geadelt worden und durfte seinen Adelstitel in der Schweiz auch führen. Ausserhalb von Winterthur besass er ein grosses Gut, welches er sehr monarchistisch lenkte. Dennoch kümmerte er sich voll Interesse um seine Pächter, den Ertrag, die Tiere, jedenfalls, wenn er sich überhaupt auf seinem Gut befand. Der Aufenthalt bei Hofe behagte ihm mehr. «En Stieregrind» habe er gehabt -und ihn seiner Tochter vererbt. Auch den Geiz, den er trotz grossem Wohlstand seiner Frau und seinen Kindern gegenüber an den Tag gelegt habe, musste die Tochter als Bürde durchs Leben tragen. Als junges Mädchen heiratete Fanny Heinrich Moser, Erbauer der Wasserwerke Schaffhausen und Uhrengrossindustrieller. Aus erster Ehe waren erwachsene Kinder da. Zu ihrem Unglück schenkte Fanny nur Mädchen das Leben: Fanny kam 1872 zur Welt, Mentona zwei Jahre später, 1874, einige Tage vor dem Tode Heinrich Mosers.
Beide Mädchen erblickten in Badenweiler, dem Ort des jährlichen Sommeraufenthalts der Familie, das Licht der Welt. Dort, wo sich auch das Grossherzogliche Ehepaar jeweils aufhielt. Den Winter verbrachten sie, auch manches Jahr nach dem Tode des Gatten noch, in Karlsruhe, ebenfalls in Anwesenheit Ihrer Grossherzoglichkeit. Der Neid der Kinder aus Heinrichs erster Ehe brachte Gerüchte über den Tod des Vaters in Umlauf. Obwohl sie bereits zu seinen Lebzeiten grosszügige Abfindungen erhalten hatten, mochten die Stiefkinder der jungen Witwe ihren Wohlstand nicht gönnen. Die beiden Mädchen lernten also ihren Vater gar nicht kennen. Ihre Mutter vermied seine Erwähnung, nur eine Büste gab eine gewisse Vorstellung von seinem Aussehen. Selbst des Vaters Verwandte wurden totgeschwiegen. Als die Mädchen grösser wurden, erhielten sie das ausdrückliche Verbot, weder von sich aus etwas über die Familie zu erzählen, noch sich ausfragen zu lassen. Welche Angst verbarg sich hinter diesem Verbot? Was stimmte nicht mit der Vergangenheit? Der Name Mentona weist doch immerhin darauf, dass die Eheleute miteinander eine glückliche Zeit im südfranzösischen Städtchen Menton verbracht haben. Auch in anderer Hinsicht hielt Fanny ihre beiden Töchter sehr lieblos. So wurde im Schlafzimmer der Mutter immer eine frische Rute im Wasser bereitgehalten. Die Erzieherinnen wurden entlassen, wenn die Mutter spürte, dass eine ihrer Töchter diese liebzugewinnen begann. Durch häufiges Umherreisen, immer volles Haus, den aufwendigen Lebensstil der Mutter, welches alles ihre Unzufriedenheit nicht zu vertreiben vermochte, entwickelten Fanny und Mentona früh schon eine Abneigung gegen Geld und Aristokratie. Die Ältere, Fanny, konnte sich durch Bravsein und Anpassung noch eine Zeitlang eine Art Liebe der Mutter erhalten. Die Kleinere aber, Mentona, fühlte sich immer als Aussenseiterin und empfand dementsprechend die Art der Mutter in verstärktem Masse als lieblos, kalt, und hat sie auch so geschildert. Ein Leben lang konnte sie dies der Mutter nicht verzeihen. Das Negativ-Vorbild, das ihr die Mutter war, wirkte dafür auch ganz stark in die entgegengesetzte Richtung. Sobald sie zur Ausbildung in England war, begann sie sich für die Arbeiterfrage zu interessieren, schrieb sich sofort auf zwei Jahre später für ein Sozialhelferinnen-Jahr in London ein. Während dieser Zeit hat die ältere Schwester Fanny ihre Studien bereits begonnen, zuerst Medizin, dann Zoologie. Auf letzterem Gebiet dissertierte sie und erlangte internationalen Ruf. Diesen erwarb Fanny sich anschliessend auch auf ganz anderem Gebiet: in der Parapsychologie. Dies nun aber erst nach dem Tode ihres Mannes, den sie während mehr als zehn Jahren aufopfernd gepflegt hatte. Hier zeigte sich einmal mehr die harte Seite der Frau Moser-Sulzer von Warth, mehrfach sogar. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges hätte des Ehepaar der Unterstützung der Mutter bedurft, um sich in Wädenswil niederlassen zu können, denn durch widrige Umstände ist es in den Wirren der staatspolitischen Ereignissestaatenlos geworden. Die Mutter wollte sie aber nicht in ihrer Nähe haben. So unternahm sie trotz mannigfacher Beziehungen rein gar nichts für das Ehepaar. Knapp zwanzig Jahre nach dem Tod des Gatten erhielt die Tochter Fanny ihr Schweizer Bürgerrecht wieder. Von 1943 bis zu ihrem Tode 1953 lebte sie dann in Zürich. Die parapsychologischen Interessen Fannys seien bereits auf der Au geweckt worden. Damals nämlich befand sich Dr. Heim nicht nur wegen Käpfnach auf der Au, sondern auch, um eigenes Wasser fürs Haus zu finden. Wünschelrutengänger wurden besprochen, Herr Fore! erzählte von hypnotischen Brandwunden, Sigmund Freud trug auch sein Scherflein zur Unterhaltung bei. Die Mutter begab sich auch einmal einen Sommer lang nach Wien, um sich durch ihn von ihrer nervlichen Überbeanspruchung kurieren zu lassen. Dieser Sommer sei -gemäss Mentona -der schönste ihrer Jugendzeit gewesen, nur unter der Aufsicht und umgeben von der Liebe einer Erzieherin und des Hausmädchens. Zum Hypnotiseur nach Stockholm begleiteten die Töchter ihre Mutter ebenfalls. Auch diese Behandlung zeigte als Erfolg nur einen missglückten Selbstmordversuch Mentonas auf dem Heimweg von Stockholm.
Fanny Moser, 1872−1953.
Mentona Moser, 1874−1971.
Werdmüllergut auf der Hinteren Au, erbaut 1651, abgebrochen 1928. Aufnahme um 1900.
Die Hektik, welche von der Mutter ausging, von der sich Mentona nur in der Au einigermassen flüchten konnte, setzte sich wider Willen in Mentonas eigenem Leben fort. Ständig hetzte sie umher zwischen Parteiarbeit -zuerst Sozialistischer, dann Kommunistischer Partei -, Arbeit für die Pro Juventute zum Lebensunterhalt, welche stark mit Reisen innerhalb der Schweiz verbunden war, Spitalbesuchen bei ihrem schwerbehinderten Sohn, dem Kinderheim für ihr Töchterchen und späteren Aufgaben in der Sowjetunion. Dabei hätte sie nichts anderes gewollt, als ihren Kindern das zu geben, was sie selbst als junges Mädchen so schmerzlich vermissen musste: Liebe und Geborgenheit! Sogar Freud kommt in seinen Studien über Frau Moser zum Schluss, dass sie eine Tyrannin gewesen sei, welche sich stets weigerte, ihren Töchtern auch nur im geringsten beizustehen, wenn diese in Not waren. Diese Antwort gab er auf eine Anfrage der Tochter Fanny, die ein gerichtliches Verfahren gegen ihre Mutter anstrebte. Nicht einmal im Tode durften ihre Töchter ihr nahekommen. So lauteten die Anordnungen in ihrem letzten Willen. Halten wir noch einige Ähnlichkeiten dieser drei Frauen fest. Ähnlichkeiten von Charakterzügen, welche wohl keine der drei so recht an sich wahrhaben wollte, die sie aber um so mehr in den anderen verachteten: Gleich war ihnen ihr ungeheurer Ehrgeiz. Gut genug war nicht genug. Denn noch schätzte jede ihre Kräfte, Fähigkeiten und Möglichkeiten immer wieder falsch ein. Jede war in ihrem Gebiet sehr bedeutend, wollte aber immer auch noch Sachen in Angriff nehmen, von welchen im vornherein klar war, dass sie nicht ganz bewältigt werden konnten. Keine war mit der ihr gegebenen Anerkennung zufrieden, sondern suchte sich im Gegenteil auch in Kreisen zu bestätigen, wo sie überhaupt nicht hingehörte. Alle drei konnten auch in hohem Alter nicht verzeihen, fühlten sich verkannt, vernachlässigt. Privat tragische Gestalten! Betrachtet man aber ihre Wirkung für die Öffentlichkeit, sieht alles ganz anders aus. Das Werdmüllergut auf der Au ist wirklich zu einem Hort geistiger Regsamkeit, grossen Gedankenaustausches geworden. Manche Verbindungen sind in diesem Haus geknüpft worden, manche Idee fand hier ihren Ursprung. Beide Töchter haben grossartiges geleistet: Mentona für den Kommunismus, für den Frauenverein Zürich, für Pro Juventute mit Säuglingspflegekursen und Mütterberatung; sie kannte Lenin und viele weitere damals von Zürich aus tätige Menschen; ein Kinderheim in Russland wurde von ihr gegründet und geführt. Ihre Arbeit wurde im Osten immerhin so sehr gewürdigt, dass sie ihren Lebensabend im Veteranenheim in Ostberlin verbringen durfte und im Ehrenhain für Sozialisten bestattet liegt. Tochter Fanny wiederum besass eine der grössten Parapsychologischen Bibliotheken, welche sie vollumfänglich dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg im Breisgau vermachte. Für die Öffentlichkeit drei nicht zu unterschätzende Persönlichkeiten!
Thekla Lehnert, 1879−1978
Zum Schluss darf auch eine Frau nicht fehlen, welche im Zusammenhang mit Frau Weber von der Brauerei erwähnt wurde. Dies ist die Schwägerin von Fritz Weber, des einen Sohnes, für den die Brauerei damals weitergeführt worden war: Thekla Lehnert.
Öffentlich ist nicht manches von ihr bekannt. Sie lebte in München, kam aber für längere Aufenthalte immer wieder zu ihrer Schwester nach Wädenswil. Wenn man nachforschen würde, käme sicher das eine oder andere noch zutage. Das ist aber für uns heute gar nicht so furchtbar wichtig. Sie habe bei ihrer Schwester gelebt, sich sehr emanzipiert gegeben, war nicht verheiratet, fiel der Wädenswiler Bevölkerung auf durch ihre besondere, damals etwas ausgefallene Kleidung und Haartracht. Sie zeigte eine ausgesprochene Vorliebe für weite, lange, violette Kleider und Capes. Die Haare soll sie entweder offen getragen oder im Nacken zu einem losen Schwanz zusammengebunden haben. Für uns hier bedeutend ist sie aber weniger durch diese Eigentümlichkeiten als vielmehr dadurch, dass sie Märchen schrieb, Märchen für Erwachsene: «Von tanzenden Blumen und brennenden Steinen.» Nur noch wenige Exemplare dieses Buches sind vorhanden. Schade, denn gerade in den letzten Jahren ist man sich aufs neue wieder dessen bewusst geworden, was Märchen für alle Menschen bedeuten.
Öffentlich ist nicht manches von ihr bekannt. Sie lebte in München, kam aber für längere Aufenthalte immer wieder zu ihrer Schwester nach Wädenswil. Wenn man nachforschen würde, käme sicher das eine oder andere noch zutage. Das ist aber für uns heute gar nicht so furchtbar wichtig. Sie habe bei ihrer Schwester gelebt, sich sehr emanzipiert gegeben, war nicht verheiratet, fiel der Wädenswiler Bevölkerung auf durch ihre besondere, damals etwas ausgefallene Kleidung und Haartracht. Sie zeigte eine ausgesprochene Vorliebe für weite, lange, violette Kleider und Capes. Die Haare soll sie entweder offen getragen oder im Nacken zu einem losen Schwanz zusammengebunden haben. Für uns hier bedeutend ist sie aber weniger durch diese Eigentümlichkeiten als vielmehr dadurch, dass sie Märchen schrieb, Märchen für Erwachsene: «Von tanzenden Blumen und brennenden Steinen.» Nur noch wenige Exemplare dieses Buches sind vorhanden. Schade, denn gerade in den letzten Jahren ist man sich aufs neue wieder dessen bewusst geworden, was Märchen für alle Menschen bedeuten.
Marlies Bayer-Ciprian