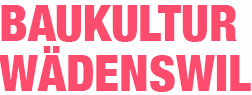JUGENDERINNERUNGEN AN WÄDENSWIL
Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1996 von Max Stoop
Offenbar sind meine in den Jahrbüchern 1994 und 1995 veröffentlichten Zeilen bei der Leserschaft angekommen; jedenfalls hat man mich zu einer Fortsetzung ermuntert. So verfasste ich diese dritte Folge meiner Erinnerungen an eine glückliche, in einem schönen Dorf verlebte Jugendzeit, und manche Szene wurde wieder lebendig.
IM REBLAUBENQUARTIER
Ich wuchs an der Seestrasse auf, und zwar im Quartier des Reblaubenwegs. Jene Umgebung hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten baulich sehr verändert. Wenn ich aus einem Fenster meines Elternschlafzimmers blickte, so sah ich im Uhrzeigersinn die Häuser der Tuchhandlung Emil Denzler und des Fotogeschäfts Fritz Langendorf mit dem Notar-Nägeli-Anbau, und dann das Wohnhaus mit der Mercerie der Geschwister Brupbacher. Gegenüber der Liegenschaft Brupbacher befand sich das ehemalige Fleckenstein-Riegelhaus, dessen südlicher Teil aber Malermeister Frey gehörte und im untersten Geschoss den Stoffladen der Schwestern Frey (nicht mit Maler Frey verwandt) beherbergte. Den Kranz der Häuser schloss gegen Nordwesten die alte Sparkasse ab.
Das Sparkasse-Gebäude wurde anfangs der vierziger Jahre von unserem Hausarzt, Dr. Fritz Stiefel sen., erworben; als Nachfolger von Dr. Florian Felix hatte er bis anhin in der Gerbe praktiziert. Vor allem die Gartenanlage gegen den Reblaubenweg hin liess er vollständig neu gestalten und mit einer hübschen freistehenden Garage versehen. Dr. Stiefels dunkelrote, zweisitzige Mercedes-Cabriolets − er besass in den vierziger und fünfziger Jahren nacheinander deren drei − hatten es mir angetan.
Das Sparkasse-Gebäude wurde anfangs der vierziger Jahre von unserem Hausarzt, Dr. Fritz Stiefel sen., erworben; als Nachfolger von Dr. Florian Felix hatte er bis anhin in der Gerbe praktiziert. Vor allem die Gartenanlage gegen den Reblaubenweg hin liess er vollständig neu gestalten und mit einer hübschen freistehenden Garage versehen. Dr. Stiefels dunkelrote, zweisitzige Mercedes-Cabriolets − er besass in den vierziger und fünfziger Jahren nacheinander deren drei − hatten es mir angetan.
Der Reblaubenweg im April 1949: Links im Bild ist das Schöpfchen der Liegenschaft Denzler noch angeschnitten sichtbar: im Hintergrund das Haus Brupbacher und das Fleckenstein-Riegelhaus, rechts die alte Sparkasse und im Vordergrund die kleine Garage von Dr. med. F. Stiefel sen.
Die Fleckenstein-Liegenschaft, ein früheres Bauernhaus, gehörte Paul Blattmann sen., dem «alten Blächpauli», der im letzten Jahrbuch von Hans Scheidegger so treffend beschrieben wurde und seinerzeit alle Häuser bis hin zum Floraweg aufgekauft hatte. Dort hinten befand sich auch ein Garagegebäude, das kurz nach dem Krieg Opfer eines Brandes, aber wieder aufgebaut wurde. Eine der Einzelgaragen war von den Camionneuren Gebrüder Baumann belegt, die dort ihren Citroen-Kleinlastwagen einstellten. Der Citroen bekam beim Brand einiges ab, wurde jedoch wieder makellos instand gestellt, so dass er nachher glänzte wie nie zuvor! Ein Beispiel, wie man damals sparen und zu seinem Eigentum Sorge tragen musste, denn Automobile gab es noch nicht im Überfluss. Überdies waren die Handwerkerlöhne viel tiefer und bezahlbarer als heute, und auch aufwendige Instandstellungen lohnten sich in jedem Falle.
DIE BADI HATTE ES IN SICH
Das eben erwähnte Fleckenstein-Haus wurde vom Herrenschneider August Hörnis und seiner Familie bewohnt. Schneider Hörnis hinkte stark und ging an einem Stock, denn er hatte ein sogenanntes Holzbein. Ich bewunderte ihn, dass er trotz seiner Unterschenkelprothese die Seebadanstalt regelmässig besuchte, sich dort ihrer entledigte und mit seinem Stummelbein zum Floss hinaus schwamm.
Ein guter Schwimmer war auch einer seiner Söhne. Hörnis junior studierte Theologie und war als junger katholischer Vikar eine Zeitlang in Wädenswil tätig. Per Velo sah man ihn dann in seinem schwarzen Gewand durch die Strassen flitzen, jedermann freundlich grüssend. Wir gaben ihm den durchaus nicht abschätzig gemeinten Übernamen «Velopfahrer». − Auch in der alten Badi tauchte er auf, das tat er wortwörtlich und so oft es seine Pflichten erlaubten. Er liess es sich dabei nicht nehmen, trotz seines geistlichen Standes mit dem Jungvolk beider Konfessionen Wasserfangis zu spielen. Ein katholischer Pfarrer in der Badehose, das war anfangs der fünfziger Jahre wahrlich nichts Alltägliches!
Einmal schwamm Vikar Hörnis zusammen mit zwei oder drei jungen Burschen so weit in den See hinaus, dass die kleine Schar voll Tatendrang beschloss, in Männedorf zu landen, statt in die Badi zurückzukehren. Gesagt − getan, und drüben angekommen, bestiegen sie in den Badehosen das Kursschiff und baten um «Asyl». Da ihnen die Bootsbesatzung nicht zumuten konnte, auch den Rückweg schwimmend zurückzulegen, nahm man sie auf − ohne Kleider und Fahrgeld, gewissermassen als in Seenot Geratene. − Die Sache lief dann allerdings nicht ohne Verwarnung ab, da die Übermütigen ohne Bootsbegleitung spontan eine Seeüberquerung unternommen hatten; das Ganze hätte wirklich auch schief ausgehen können ...
VELOS UND SCHREIBMASCHINEN
Noch schnell möchte ich in meine frühere Jugend zurückblenden. Als fünfjähriger Knirps erhielt ich von den Eltern ein elegantes Wisa-Gloria-Dreirad mit Sattel (also keines der damals noch üblichen «Brettlivelos») zu Weihnachten geschenkt. Wie stolz ich war! Nun konnte ich meinen Vater am Mittag im Geschäft an der Oberdorfstrasse abholen! Der Kindergarten war ja um elf Uhr aus, und mir blieb genügen Zeit, um gegen Viertel vor zwölf mit dem Dreirad zu Hause loszufahren. Im Vergleich zu heute hatte es natürlich nur schwachen Verkehr auf den Strassen. Trotzdem erstaunt es mich rückblickend doch etwas, dass mich meine Mutter so mir nichts dir nichts ziehe liess. Zuerst pedalte ich den Reblaubenweg hinauf; der war ja damals noch durchgehend bis zum Hirschenplatz. Dann ging's am Coiffeursalon von Ernst Bär vorbei und über die Florhofstrasse. Vor dem Florhof war das Trottoir, das ich entlang der Zugerstrasse benützen musste, besonders schmal, und wenn ich nicht aufpasste, streifte ich an der engsten Stelle mit der Radkappe die Hausmauer. Weiter ging’s am Warenhaus Nordmann, an der Apotheke Meyer, am «Beck» Staub und am «Tuch-Pfister» vorbei. Dann bei der «Villa Hebdifescht» über die Strasse zum «Rössli», am «Chole-Langedorf». und am Baugeschäft Ferrari vorüber bis zum Hosliweg. Dann strampelte ich die letzten Meter bergan bis zum «Ööl-Hürlimaa», wo mein Vater beschäftigt war.
Das Hirschenquartier in den 50er Jahren: Vorne link das im Text erwähnte schmale Trottoir vor dem Florhof, im Mittelgrund der Coiffeursalon Bär mit dem oberen Ende des Reblaubenwegs, dann der alte Sonnenhof und die Liebenschaften Langendorf und Denzler.
Dort stellte ich das Velo unter die Verladerampe, stieg das Freitreppchen hinauf zum Büro, klopfte an und wartete auf das «Herein». Darauf wurde ich von den Angestellten regelmässig freundlich empfangen und durfte mich sogar auf einer der Underwood- oder der Remington-Schreibmaschinen in ersten Schreibkünsten üben. So schrieb ich als Kindergärtier die Buchstaben auch von Hand mit «Füsschen», wie sie von den Typen der Schreibmaschine aufs Papier gedruckt wurden. Die einfachen Striche und Bögen, wie wir sie dann in der ersten Klasse auf die Tafel kritzeln mussten, dünkten mich nachgerade banal. Sicher war meine frühe Bekanntschaft mit Schreibmaschinen irgendwie für das spätere Leben prägend.
Nochmals zu den Velos: Mein Dreirad wuchs leider nicht mit mir, und in späteren Jahren kurvte ich damit nur noch zum Spass gelegentlich auf unserem grossen Estrichboden herum, die Knie meiner länger gewordenen Beine nach auswärts gerichtet, um nicht mit der Lenkstange in Konflikt zu geraten. An ein Zweirad durfte ich gar nicht denken, das war viel zu teuer, und nicht einmal meine Eltern besassen ein solches.
So lernte ich erst im Sekundarschulalter Velo fahren, mich mit älteren Damenfahrrädern abmühend, wobei mein Schulfreund Jürg Hochstrasser als geduldiger Helfer und Instruktor amtete. Endlich war es dann so weit: Ich vermochte das Gleichgewicht zu halten und mit dem Rad eine längere Strecke zurückzulegen, ohne dass jemand hinterher rannte und mich am Gepäckträger stützte. «Chasch es ja!» rief Jürg begeistert. Welch ein Gefühl! So musste es einem jungen Vogel zumute sein, der eben fliegen gelernt hatte!
Bald unternahmen mein Freund und ich längere Fahrten, so zum Beispiel einmal während der Schulferien zum Hof Oberkirch nach Kaltbrunn im Gasterland, wo Jürg seit einem Jahr die Internatsschule besuchte, die vom Wädenswiler Dr. Fritz Schwarzenbach geleitet wurde. − Oder man vergnügte sich ganz einfach mit weiteren Schulkollegen auf dem Seeplatz, übte sich im Langsam- und Zickzackfahren und versuchte, den andern abzudrängen und zum Absteigen zu zwingen.
DER «ERNST DES LEBENS» NAHT
Mittlerweile rückte das Ende der Schulzeit langsam heran. Auf der einen Seite war ich froh, die Schule bald hinter mir zu wissen, aber andererseits war mir vor der unbekannten Zukunft doch ein bisschen bange. Ich hatte mich für eine kaufmännische Lehre entschlossen, obschon mich auch der Grafikerberuf gereizt hätte, doch: davon wusste ich zu wenig Genaues. Mein Vater erkundigte sich also beim Schulleiter der kaufmännischen Berufsschule, Sekundarlehrer Bleuler, nach offenen Lehrstellen. Dieser sagte, es kämen am ehesten die Tuchfabrik Pfenninger oder die Brauerei in Frage. Und eines Tages meldete er mir in einer Pause: «Chasch dänn dem Vatter säge chöngisch id Brauerei.» − So redete man damals mit einem Schüler, der als angehender Lehrling immerhin die Hauptperson im ganzen Spiele war...
Und an einem schulfreien Nachmittag trottete ich vereinbarungsgemäss zu den Büros der Brauerei Wädenswil, um mich vorzustellen. Prokurist Ernst Hosner empfing mich freundlich, und man wurde einig; das Ganze war ja nurmehr eine Formsache. Man werde mir den Lehrvertrag demnächst zustellen.
Ein letztes Mal geniesst man gemeinsam Schulferien (Frühling 1949). Ein Gelegenheitsfotograf erwischte die drei Freunde beim Velofahren auf dem Seeplatz: von links Hans Höhn (genannt Bartli), Jürg Hochstrasser und der Autor dieser Zeilen. Das Haus im Hintergrund ist der Jakobshof, wo sich damals die Schlosserei von Fritz Treib befand, davor das alte Barrierenwärterhäuschen des inzwischen aufgehobenen öffentlichen Bahnübergangs.
Am Ostermontag 1949, der zugleich das Ende meiner letzten Volksschulferien markierte, fuhren meine Eltern und ich mit dem Dampfschiff nach Rapperswil. Es herrschte prächtiges warmes Wetter. Beim anschliessenden Spaziergang über den Seedamm wurde in einer Gartenwirtschaft in Hurden eingekehrt, und mein Vater bestellte eine Stange Ur-Hell, das zartbittere Spezialbier der Brauerei Wädenswil. Ich bat ihn um einen Schluck, damit ich wenigstens wisse wie Bier schmecke − denn schon am nächsten Tag kam ja für mich der Start ins Berufsleben.
LEHRJAHRE IN DER BRAUEREI ...
So strebte ich an jenem für mich denkwürdigen Dienstagmorgen des 19. April 1949 die Seestrasse hinaus, der Brauerei zu. Die Knickerbockers hatte ich nun auch werktags gegen lange Hosen getauscht, aber ich fühlte mich in diesem Gwändli samt Krawatte nicht so recht zu Hause. Für meine Begriffe viel zu rasch war ich dort draussen an der Schmidgass angelangt, ich stiess die Haustür des Braui-Büros auf und läutete am Schalter. Martha Odermatt, meine zukünftige Oberstiftin, öffnete mir und hiess mich herzlich willkommen. Wenigstens das, dachte ich und spürte, in ihr eine Verbündete zu haben, wenn alles schiefgehen sollte.
Doch es ging nichts schief. Die neue Arbeit gefiel mir sogar und hatte erst noch den Vorteil, dass es am Monatsende den Zahltag gab. Bereits nach einem Jahr konnte ich mir davon ein eigenes, chromglänzendes Velo mit Dreigang-Nabe kaufen. Beim Fahrradhändler Otto Schweizer am Hoffnungsweg kostete dieses 430 Franken; das war recht viel Geld für damals. Aber eben meine erste selber verdiente Anschaffung. Einmal fuhr ich an einem Samstagnachmittag (am Vormittag wurde ja bis 12 Uhr gearbeitet, nota bene!) mit meinem neuen Rad sogar nach Zürich, kurvte elegant um die vielen Tramschienen herum und kam mir vor wie ein König.
Brauerei Wädenswil (rechts) und Tuchfabrik Pfenninger (links) mit Cavallasca-Haus, abgebrochen 1936. Auf der Seestrasse Dienstmann Robert Sigrist.
Einige Monate später hatte ich das Geld für eine eigene Portable-Schreibmaschine beisammen. Ich erstand mir im Fachgeschäft der Rosa Kubli für 450 Franken eine Hermes 2000 − ich besitze sie heute noch, auch wenn ich nur noch selten darauf tippe.
Wädenswil hatte damals noch seine eigene kaufmännische Berufsschule. Als Lehrkräfte wirkten zum Grossteil einige Primar- und Sekundarlehrer, aber auch ein paar Vertreter des kaufmännischen Berufsstandes erteilten vor allem in den Fächern Maschinenschreiben, Stenografie und Buchhaltung Unterricht. Rechtskunde hatten wir bei dem begabten Wädenswiler Notar Wild.
Etwa zweimal in der Woche reichte der Unterricht bis in die Abendstunden hinein. Zusammen mit den Hausaufgaben war das Tagespensum neben der Büroarbeit recht happig. Die Schulferien kamen mir deshalb jedes Mal vor wie richtige Ferien, denn die Arbeit im Büro machte mir Spass. Wir hatten in der Braui ein gutes Betriebsklima und Angehörige der Besitzerfamilie Weber bildeten eine loyale Geschäftsleitung. Bei allen Pflichten liess man einander leben.
Der ganze Betrieb der Brauerei faszinierte mich ungemein. Ich wusste mit der Zeit nicht nur, wie das Bier schmeckte, sondern auch − wenigstens theoretisch und der Spur nach − wie man es braute, gären liess und lagerte. In Wädenswil wurde während der Wintermonate auch noch Gerstenmalz erzeugt; man war also in der Lage, den edlen Gerstensaft wirklich von A bis Z im eigenen Hause herzustellen. Auch wenn Spassvögel behaupteten, Bier bestehe zu 98 Prozent aus Wasser und zu 2 Prozent aus Geschäftsgeheimnissen: ich wusste es nun besser und hatte Respekt vor der Braukunst.
In der Schweiz gab es damals noch gegen 60 selbständige Brauereien. Wädenswil figurierte ausstossmässig unter den ersten zehn und gehörte mit Feldschlösschen Hürlimann, Eichhof Luzern, Cardinal Fribourg, Haldengut Winterthur, Warteck Basel, Salmen Rheinfelden und Löwenbräu Zürich zu den bedeutenden einheimischer Unternehmen der Branche.
Der brauereitechnische Betrieb war unter Braumeister Anton Friedrich, einem echten Bayern und Absolventen der Brauereihochschule Weihenstephan, straff und vorbildlich geführt. Von ihm, einem vielseitig interessierten Menschen mit hoher Allgemeinbildung, den man innerhalb der Firma normalerweise mit «Herr Braumeister» anredete, erhielt ich jede nur erdenkliche Auskunft, um meine Wissbegier zu stillen − und natürlich auch − um mich auf die Branchenkunde der Lehrabschlussprüfung vorzubereiten.
... MIT GUT VERLAUFENEM LEHRABSCHLUSS
Ja, diese Abschlussprüfung lag mir schon Monate vorher wie ein Klumpen Blei im Magen ... Die Braui-Lehrlinge vor mir, August Züger und Martha Odermatt, hatten beide mit dem ausgezeichneten Durchschnitt von 1,2 abgeschnitten (Note 1 war die beste, Note 5 die schlechteste). Ich kannte mich selber nur zu gut, um zu wissen, dass das bei mir nicht drin lag. Die Resultate bis und mit Note 1,5 wurden jeweils im «Allgemeinen Anzeiger vom Zürichsee» abgedruckt, und zwar nicht nur mit den Namen der Lehrlinge, sondern auch mit jenen der Lehrfirmen. Das war genau der Haken an der Geschichte, und ich wusste genau, meine Vorgesetzten − allen voran Prokurist Ernst Hosner − erwarteten, dass die Brauerei Wädenswil auch diesmal «in den Rängen» figurieren und in der Zeitung erscheinen werde.
Die schlimmen Tage der Abschlussprüfung kamen. Zuerst mit den Fächern Maschinenschreiben und Englisch mündlich und dies sage und schreibe an einem Samstagnachmittag! Dann am Montag ging es richtig los mit all den todernsten Dingen wie Rechnen, Buchhaltung und Stenografie. Vor allem mit der Steno stand ich auf Kriegsfuss, denn ich hatte mir im zarten Alter beim rechten Zeigfinger ein «Knödli» angewöhnt und bekam daher beim Schnellschreiben rasch den Krampf in der Hand. In der Branchenkunde und den Sprachen befürchtete ich nicht viel, doch einzig dem Fach Aufsatz sah ich gelassen entgegen. Dass die Aufsatznote doppelt zählte, jene der Stenografie hingegen mit dem Maschinenschreiben zur Einzelnote Stenodaktylografie zusammengezogen wurde, war mir ein kleiner Trost.
Trotzdem hatte ich nach den Prüfungen panische Angst, ich sei wegen der blöden Steno durchgerasselt. Der Abend der Abschlussfeier im alten Hotel Meierhof in Horgen aber kam so sicher wie das Amen in der Kirche (um es mit einer heutzutage modischen Umschreibung auszudrücken). Mit sehr gemischten Gefühlen und einer Appetitlosigkeit, die mich schon seit Tagen verfolgte, fuhr ich nach Horgen. Es wohlte mir erst ein wenig, als ich auf der Meierhof-Treppe meinem Nachbarn Walter Furrer begegnete, der als Drogist Experte bei den Verkäuferinnen-Prüfungen war. Er drückte mir strahlend die Hand und sagte: «Max, du bisch denn no cheibe guet!» Doch noch immer nagten in mir einige Zweifel; Herr Furrer hätte sich auch täuschen können...
Den genauen Ablauf der Feier weiss ich nicht mehr. Doch bald wurde zur Rangverkündigung geschritten, und die Spannung stieg ein letztes Mal. Aber siehe da: mein Notendurchschnitt hiess 1,5, und ich kam in der Folge mit meinem eigenen Namen und jenem der Brauerei in die Zeitung! Ich war überglücklich, das mir selber gesteckte Ziel erreicht zu haben und konnte fortan den Abend der Abschlussfeier im Kreis der Kolleginnen und Kollegen bei Speis und Trank und Tanzmusik in vollen Zügen geniessen. Das bange Warten hatte sich − wie ich im Lauf meines weiteren Lebens noch so oft erfahren durfte − in einen der glücklichsten Momente gewandelt, die man nie vergisst.
Im Geschäft begrüsste mich Prokurist Hosner mit schelmischem Schmunzeln und einem «'s het grad no glänggt» in seinem Berndeutsch. Der Braui blieb ich nach der Lehre noch weitere drei Jahre treu und verbrachte unter Buchhaltungschef Hans Bodmer eine sehr schöne, nur durch die Rekrutenschule unterbrochene Zeit. Als ehemaliger Stift konnte ich auch in anderen Abteilungen Ferienablösungen machen, denn schliesslich kannte ich ja alles und war während der Lehre überall «durchgeschleust» worden. Diese Ablösungen erfüllten mich jeweils mit einigem Stolz und grosser Befriedigung.
Aber ich wollte noch meine Sprachkenntnisse im Welschland vertiefen, und der damalige kaufmännische Juniorchef, Paul Weber, verhalf mir zu einem befristeten Engagement im Filialbetrieb der Brasserie du Cardinal in Genf. Kaum war ich unten in der Rhonestadt richtig angesiedelt, erreichte mich die Kunde, dass Peter Walter, einer der beiden Brauerei-Juniorchefs, mit dem Auto tödlich verunglückt sei. Diese Nachricht traf mich sehr. Der stets zu Spässen aufgelegte Walter hätte als technischer Direktor die Nachfolge des bereits 85-jährigen Fritz Weber-Lehnert antreten sollen, der diesen Schicksalsschlag nicht lange überlebte.
JA, DIE AUTOS
Seitdem der Krieg vorbei war und die Autos wieder die Strassen zu bevölkern begannen, erwachte in mir das Interesse an diesen Vehikeln. In Wädenswil war es die Zentrum-Garage, die als erste fabrikneue Personenwagen feilhielt. Es waren dies schmalbrüstige Engländer der Marke Austin, die durch die Firma Emil Frey importiert wurden. Doch sie fesselten mein Interesse, so altertümlich sie auch aussahen. Immerhin waren die bald dazukommenden Jaguar-Modelle bedeutend vornehmer und rassiger.
Solch schmalbrüstige Austin Wägelchen waren unmittelbar nach dem Krieg die ersten Personenautos, welche die Zentrum-Garage verkaufte.
Sehr rasch kannte ich alle Marken mit ihren Merkmalen vom Sehen auswendig und ich begann − damals noch ein Sekundarschüler − an Sonntagvormittagen auf dem breiten Sims unseres auf die Seestrasse hinaus führenden Gangfensters sitzend, die vorbeifahrenden Autos zu zählen. Aber nicht einfach so, sondern gegliedert nach Marken wurden Striche gemacht, wie beim Jassen. Die Marke, die zuerst 50 Exemplare erreichte, hatte gewonnen. Meist hiess der Sieger Fiat, gefolgt von Ford. Von VW war hingegen noch keine Spur zu sehen, denn die neue deutsche Marke, die mit ihrem «Käfer» einmal die Welt erobern sollte, wurde erst ab 1948 importiert.
Mit meinem Freund Jürg Hochstrasser fuhr ich einige Male an schulfreien Nachmittagen per Bahn nach Zürich auf «Prospekt-Razzia». Unsere Streifzüge führten uns fast immer ins Seefeldquartier, denn dort waren die meisten namhaften Autofirmen angesiedelt: Schlotterbeck, Tip-Top-Garage, Willy, Strehler-Jauch, Blank, Fiat und Amag. Die letztgenannte ist dem Utoquai sogar bis heute treu geblieben. Mit der Zeit baute ich mir eine respektable Autoprospekt-Sammlung auf, die ich heute noch hege und pflege. − Einmal ein Fan, immer ein Fan!
Dann kamen Jaguar-Modelle hinzu, die dem hier abgebildeten Exemplar entsprachen. Kaum weniger altmodisch, aber doch bedeutend eleganter in ihrer Erscheinung waren diese, heute als «Classic Cars» geltenden Wagen.
Ich schwor mir damals: Sobald du die Lehre beendet hast, lernst du Auto fahren! Dies tat ich denn auch, 1952 in Zürich auf einem hochbeinigen Amerikanerwagen der Marke Nash. Das Fahren fiel mir nicht leicht, denn ausser in den Fahrstunden kam ich kaum zum Üben. Dennoch schaffte ich die Führerprüfung im ersten Anlauf − und mit viel Schwein!
Danach mietete ich ab und zu ein Auto bei der Zentrum-Garage, deren Austin-Modelle inzwischen eine Spur moderner geworden waren. Dies verhalf mir mit der Zeit zu einer gewissen Fahrroutine. Doch jede grössere Tour strengte mich grauenhaft an. Das änderte sich erst, als ich mir 1957 selber eine Occasion kaufte. Und was war es? Nichts anderes als ein hochbeiniger, älterer Engländer! Nein, kein Austin, aber ein Vauxhall...
Chilbi-Sonntag 1955. Vorne die traditionsreiche Confiserie Romé, dann Senns Riesenrad, eine Schaustellerbude aus Deutschland (!) und schliesslich Rodels Bob-Bahn, auf der die neusten Rock-and-Roll-Hits abgespielt wurden.
Damit war meine eigentliche Jugendzeit vorbei. Und wie es so geht und auch heute noch die Regel ist: Auch ich legte mir eine feste Freundin zu und dachte langsam ans Heiraten...
Vieles hat sich seither geändert. Doch ein Wädenswiler bin ich geblieben. Einer, den es mindestens einmal im Jahr in seinen geliebten Heimatort zieht: über die Chilbitage nämlich!

Max Stoop