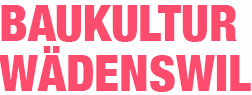WÄDENSWILER ORIGINALE II
Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1993 von Hans Scheidegger
DER SCHRIFTSTELLER PAUL FELIX (1885–1958)
Wer in den fünfziger Jahren ins alte «Du Lac» trat, konnte hie und da im ruhigeren hinteren Zimmer einen alten, krummen, etwas verwahrlosten Mann sehen, allein hinter einem Tisch sitzend, das Beret auf dem Kopf, finster vor sich hinbrütend, ein Bier vor sich. Gelegentlich liess er es zu, dass man sich zu ihm setzte, und wenn man Glück hatte, begann er zu erzählen: stockend erst und versponnen, manchmal wirr, dann wieder feurig und spannend.
Unvermittelt aber konnte seine Stimmung umschlagen, und dann fluchte und schimpfte er mit groben, wüsten Worten auf alles mögliche. – Nur noch selten spielte er Billard, mit konzentriertem, schönem Gesicht.Er tat es zwar immer noch elegant, aber seine Sicherheit und Wendigkeit hatten nachgelassen, waren offenbar nur noch ein Abglanz früherer Jahre. Irgendwie unheimlich wirkte er in seiner Unberechenbarkeit, seinem vernachlässigten Aussehen, seinem wüsten Reden: ein Sonderling war er, dieser Paul Felix, ein Original, und was für eines!
Wie aber war dieser Mensch, der so viele angesehene Männer zu Freunden hatte, in jüngeren und jungen Jahren? Ein guter Freund beschreibt ihn so: Er konnte sich überall anpassen – wenn er wollte –, sei es in der Studentenkneipe oder an der festlichen Tafel eines noblen Hauses. Damen schätzten seinen Umgang sehr, denn er war ein ausgezeichneter Unterhalter: witzig, gescheit, interessant. Freunden hielt er auf eigentümlich anhängliche Weise durch dick und dünn die Treue. Daneben konnte er sehr widrig sein: zu derbem, grobem, auch unflätigem Benehmen war er fähig. Er war ein völlig unbürgerlicher Mensch und lehnte sich gegen alles auf, was auch nur entfernt nach bürgerlicher Ordnung roch.
Paul Felix in den 1930er Jahren. Bleistiftskizze von Ernst Denzler, Wädenswil.
KINDHEIT
Am 16. September 1885 kam er in Wädenswil zur Welt. Sein Vater, Dr. Florian Felix, war Arzt; seine Mutter, Veronica Flury, verlor er schon früh. Die Familie wohnte im Haus zur Gerbe, wo der Vater auch seine Arztpraxis hatte. Paul wuchs zusammen mit drei Schwestern auf. Mit seinem Verhalten, das so weit von jeder Ordnung, oft auch von jedem Anstand entfernt war, hat er seinen Angehörigen reichlich Kummer bereitet.
Paul Felix litt seit früher Kindheit an einer Wirbelsäulenverkrümmung. Ob ein Wirbelbruch, den er als 1 ½jähriges Büblein erlitten hat, die Ursache dieser Behinderung war oder ob ein Geburtsgebrechen vorlag, lässt sich heute nicht mehr entscheiden. Er hatte einen Buckel, schräge Achseln und eine Hühnerbrust. Auf normallangen Beinen sass ein wegen seiner Verwachsung viel zu kleiner Oberkörper. – Wie sehr hat wohl seine Behinderung teil an seiner späteren originellen und schwierigen Wesensart?
Der Vater: Dr. Florian Felix.
Die vier Kinder des Arztes Florian Felix. Rechts: Paul Felix.
Das Haus zur Gerbe von Westen, um 1910. Hier hatte Dr. Florian Felix seine Arztpraxis, hier wuchs Paul Felix auf.
BERUF
Einen Beruf im landläufigen Sinn mit einigermassen geregelter Arbeitszeit hat er nie ausgeübt. Er besuchte das Gymnasium und studierte anschliessend Medizin. Sein unbotmässiges Verhalten führte aber zu dauernden Zwisten mit seinen Professoren, so dass er die Universität vorzeitig verliess.
Obwohl er mit seiner Behinderung keinen handwerklichen Beruf erlernen oder ausüben konnte, versuchte er sich für kurze Zeit als Automechaniker in einer Garage in Paris, danach sogar als Bauernknecht. Diesen körperlichen Anstrengungen war er natürlich nicht gewachsen.
Später bezeichnete er sich in der Regel als Schriftsteller. Er schrieb gelegentlich Zeitungsartikel, die eigentlich niemand so recht wollte, und ausnahmsweise brachte er auch einmal eine Novelle in einer Zeitung unter («NZZ», «Zürichsee-Zeitung»). Für seine Texte (Novellen, Romane, Essays usw.) fand er keinen Verleger. Deshalb hat er eigene Verlage gegründet: in den zwanziger Jahren den Felix-Verlag Wädenswil, in den dreissiger Jahren den Wort- und Bild-Verlag Zürich.
BUCH-VERÖFFENTLICHUNGEN
Veröffentlicht hat er offenbar nur wenig: bis jetzt habe ich jedenfalls nur fünf in Büchern veröffentlichte Texte finden können.
- Nach einem Beethoven-Abend, 1931, Wort- und Bild-Verlag, 89 Seiten
- Nur Menschen, 2. Auflage 1932, Wort- und Bild-Verlag, 111 Seiten
- Die Schelmenbüschels, 1936, Wort- und Bild-Verlag, 194 Seiten
- Das Seidenlied, 1937, Wort- und Bildverlag, 75 Seiten
- Ein Künstlerfest, in: Neue Schweizer Bibliothek Band XXXVI, 37 Seiten.
Einer dieser Texte soll etwas genauer dargestellt werden, der dritte aus dem Büchlein Nur Menschen.
Er trägt den Titel Der Messias und erzählt die Geschichte des nach 2000 Jahren erneut in die Welt gekommenen Gottessohnes. Im wesentlichen erlebt er dabei noch einmal dasselbe wie seinerzeit in Palästina: Von vielen wird er geliebt und verehrt, vorab von Menschen, denen es schlecht geht; andere missverstehen sein Anliegen gründlich, verehren ihn zwar, jedoch auf merkwürdig bigotte Weise. Von «den Mächtigen» wird er abgelehnt, des Aufruhrs bezichtigt und schliesslich auf moderne Art unschädlich gemacht: man weist ihn in eine Irrenanstalt ein. – Die Geschichte spielt während der Krisenjahre vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwo in der Schweiz.
Der Messias heisst Chaspar, seine Eltern Herta und Alois Tschümperli. Der Vater arbeitet in einer Fabrik, die Mutter besorgt den mehr als kümmerlichen Haushalt. Als Bub wird Chaspar nicht gross beachtet; er ist verträumt, man redet von ihm als von einem unklugen Menschen. Weil der sich zu gewissen Vorkommnissen recht eigenwillig äussert, wird er oft ausgelacht und bestraft. Der Lehrer in der Schule strafte ihn . . . und liess ihn zuhause einhundert Mal schreiben: der Schüler hat das Maul zu halten. Der junge Messias hatte aber zornvoll dem schnaubenden Lehrer zugerufen: «So schlage doch nicht die, so schwachen Geistes sind, denn du prügelst deine dumme Bosheit in sie hinein!»
Nach der Schule arbeitet Chaspar in derselben Fabrik wie sein Vater. Weil er ein sehr gelehriger Bursche ist, kann er schon bald als gelernter Arbeiter in die Stadt ziehen und dort in grossen Betrieben arbeiten. Immer wieder geschehen schwere Unfälle. Chaspar versucht das Leben der Arbeiter zu schützen, indem er aufzeigt, wie die Sicherheitsvorkehrungen verbessert werden könnten. Man hat sich die Sache gern angeschaut und hat sie auf ihre Kostspieligkeit hin untersucht und als zu teuer befunden, worauf man den Messias als einen Renitenten entliess, weil er nicht nachgeben, aber die Arbeiter mit lauter Stimme am Arbeiten an der gefährlichen Stelle hindern wollte.
Etliche unter den Armen und Bedrängten sind auf ihn aufmerksam geworden. Sie werden seine Jünger und predigen von ihm, ohne dass er etwas davon weiss. Eines Tages wird er in ein Haus eingeladen, wo viele Versehrte auf ihn warten und von ihm Heilung erhoffen. Jeden einzelnen dieser Lahmen und Verkrüppelten, Verhärmten und Niedergeschlagenen fordert er auf, ihm seinen Kummer, seine Not zu klagen. – Eine hagere Alte tritt auf ihn zu:
«Höre mich, der du Gottes Sohn sein willst, bessere mir meinen Sohn, der sich mir ganz verhärtet hat und eine schlechte Dirne zur Frau nahm. Eine Dirne ins Haus, ob ich es auch mit meinem Fluch nicht haben wollte ... » Er antwortet ihr:
Ich höre dich, Frau; aber ich höre in deiner Stimme nicht, und nicht in deinen Worten einer Mutter Liebe, Frau. Geh! Durch deiner Tochter Herz musst du den Weg zurück zu deines Sohnes Liebe finden ... » Da hat sie in ihrem Sinnen beschlossen, das Herz ihrer Schwiegertochter zu gewinnen, weil dieser Mann liebevoll von ihr dachte.
Es geschehen hier Wunder, doch dem Einarmigen wächst kein neuer Arm, wohl aber weckt der Messias in ihm die Liebe: die Liebe zu seinem eigenen Leben und die Liebe zum Leben seiner Nächsten. Das Wunder wird also als innerseelischer Prozess gedeutet, ähnlich wie dies manche neuere Theologen auch tun.
Auf dem Wege zur Hochzeit, die zwei von ihm Erlöste feiern wollen, wird er genötigt, in ein Haus zu gehen, in dem unsere Schwestern und Brüder in christum versammelt sind, dich zu erwarten. Drinnen dienten wohl einhundert Menschen in grosser Inbrunst ihrem Gott und plärrten, dass dem Messias in den Ohren weh tat ... Als aber die eifrigen Beter den Messias unter der Türe stehen sahen, zögernd, da stiessen sie ein lautes Geheul aus. Sie schleppten ihn in des üblen Raumes Mitte und hiessen ihn willkommen, indem sie ein Halleluja abzusingen anhoben, das sie wohl einstudiert hatten, das aber hölzern abgehackt tönte. Des Geschreies und der Wucht, mit der sich darauf viele der Bussfertigen vor ihm auf die Kniee, auf den Boden gar mit ihrem Leib zu seinen Füssen warfen, des wilden Taumels wurde Chaspar bös. «Schämt euch! Was ist das für ein Gott, dem ihr in der Heimlichkeit dient, ihr Betbrüder und Schwestern miteinander?» Sie verstanden aber den frommen Zorn in seinen Worten nicht und waren voller Wollust willens, als rechte Büsser Gottes Strafe über sich und ihren Leib ergehen zu lassen. Da sah er wohl, dass sie ihn nicht verstehen konnten.
Die Hochzeit, zu der ihn Katharina und der Einarmige eingeladen haben, ist schon in vollem Gange, und immer noch kommen weitere Gäste dazu. Es wird ein grosses, fröhliches, aber einfaches ländliches Fest im Freien mit Handharmonika-, Geigen- und Klarinettenmusik. Der Platz vor dem Häuschen der Neuvermählten reicht nicht mehr aus, so dass auch die Strasse benützt werden muss. Als eben die Frauen mit den dampfenden Schüsseln aufwarten wollen, erscheinen Polizisten und schicken die Hochzeitsgesellschaft von der Strasse weg, da sie den Verkehr behindere. Hinter den Fabriklerhäusern, auf dem freien Industrieland, feiert die Menge weiter. Da verlangt der Fabrikherr von der Polizei aufgrund des Versammlungsverbots für streikende Arbeiter die Auflösung des Festes. Die Männer wollen sich wehren, doch Chasper bittet sie, ihn mit den zwei Polizisten ziehen zu lassen.
Im Gefängnis der Hauptstadt möchte man ihn, da eigentlich nichts gegen ihn vorliegt, wieder entlassen; aufgrund früherer Polizeiberichte wird er aber ins Irrenhaus gesteckt.
In der letzten Nacht vor seinem Tode spricht Chaspar mit dem Chefarzt des Irrenhauses und versucht, ihm seine Auffassung von Gott darzulegen ... Nun sind nach dir wohl tausend zu mir gekommen und fragten mich, ob Gott mein Vater; ich Gottes Sohn sei, und keiner wusste, dass sie Gott, ihren Vater aus ihren Herzen entlassen hatten und Narren am Geist geworden sind, da sie einen geistlos toten Gott gemacht haben, den sie aus der Welt und aus dem Leben, aus ihrer Zeit heraus . .. stellten ... Alle Narren lehrten, man müsse einem Gott jenseits des Lebens sein Menschentum, sein eines und unteilbares Menschentum vor die Füsse werfen, dass man mit diesem Köder Gott fange und erkaufe – Narren ihr!... Habt ihr nicht diesen andern, euren elendiglichen Zweckgott als Lebensziel gesteckt in eurem unfrommen Übermut?. . . Wisst ihr denn nicht mehr, dass der Mensch nur aus Liebe zum Leben, nur aus Liebe zur Schöpfung Mensch, Geschöpf sein kann? Aus Liebe zu diesem Gott, weil Gott selber die Schöpfung, das Leben ist?
Der alte Paul Felix. Bleistiftzeichnung von Ernst Denzler, Wädenswil, 1956.
Der Chefarzt hat des Messias Augen in Feuer stehen sehen und hat sich des schönen Wahnsinns darin gewundert, über den er schnell ein Buch zu schreiben willens wurde und darum gern noch länger mit dem Messias geredet hätte.
Später verabschiedet sich der Chefarzt und verspricht, morgen wieder zu kommen. Da hat der Messias dem Menschen vor ihm verzeihend die Hand geboten, da er doch erkannt hatte, dass er nach abermals zweitausend Jahren kommen müsse, zu sehen, ob seine wenigen Jünger im Dorf ... inzwischen den rechten Weg gefunden und gewiesen hätten. Mehr konnte er für den Moment nicht tun, und er verliess darum die Hülle, die sie Chaspar Tschümperli genannt hatten, den man am dritten Tag darauf begrub.
Ein interessanter Text, denn mir scheint, der Verfasser habe etwas vom Wesentlichen des christlichen Glaubens gespürt, aber zugleich auch ein sehr problematischer Text. Woran liegt es? Zum einen wohl daran, dass die auftretenden Menschen papieren wirken, ohne eigenes und eigentliches Leben dastehen, eindimensional sind. Das Ganze ist ein reines Gedankengebäude, nichts ist bildhaft und blutvoll. Zum andern aber liegt es an der Sprache, am Stil. Der Text ist oft verquält, lässt nur selten ein Fliessen aufkommen, wirkt knorrig und hie und da auch unklar. Form und Inhalt decken sich kaum.
1936 gab Paul Felix in seinem Wort- und Bildverlag Zürich den Bündner Roman Die Schelmenbüsche/s heraus. Er gehört zur Gattung der Dorfgeschichten und Dorfromane, zu Texten also, die das Leben der Dorfbewohner in seiner Enge und seinen Verstrickungen zeigen. Das Wort Schelmenbüschel ist als Fremdwort ins Romanische eingegangen und hat die romanische Betonung (auf dem ü) und die romanische Mehrzahlendung angenommen. – Wenn einem Bauern vom Nachbarn eine Sensen- oder Maschinenbreite von seiner Wiese weggemäht worden ist, so lässt er beim Mähen an jener Stelle einige Grasbüschel stehen, eben die Schelmenbüschels, so dass alle das Unrecht sehen können.
Die Fabel des Romans ist interessant, sogar spannend, doch der Stil ist – vorab in der ersten Romanhälfte – noch verworrener und gekünstelter geworden. Der Rezensent E. N. in der «NZZ» weist mit Recht darauf hin. Dazu ein Beispiel: Laut tönt ihm darauf in seinem Siegerübermut der Ruf, der Jubelschrei beim gewaltigen Kraftaufwand, beim Ansprung, zu dem er übervoll in seiner Freudigkeit einen abgrundtiefen Atemzug getan hatte – «hei – oh» – hoch auf über Wälder klingt es, und weit gelang ihm der Sprung hinüber ans feste Ufer. – Die Frau, welche dem alten Paul Felix zusammen mit seiner Schwester jeweils die Wohnung aufräumen ging, sagte über den Roman: «Das isch es Buech, wo me chuum verstande hät, was er eigetli hät wele säge», und ihr Mann doppelte nach: «Häsch eifach ales zweimal müese läse.» - Allerdings hat der Rezensent den Roman nur flüchtig gelesen, denn die Erklärung, die er für den Titel gibt, ist schlicht falsch, was den Verfasser verständlicherweise erzürnt hat.
VERÖFFENTLICHUNGEN IN ZEITUNGEN
Hie und da hat Paul Felix in einer Zeitung einen Text unterbringen können, so im April 1941 in der «Zürichsee-Zeitung» Das Seidenlied aus dem Jahre 1937. Ein Jahr früher erschien in der «Neuen Zürcher Zeitung» die kurze Novelle Tamangur, allerdings mit etwa dreissig Veränderungen gegenüber dem Original. Deswegen schrieb Paul Felix am 28. April 1936 an den Redaktor Dr. E. Korrodi unter anderem: Verehrtester, es hat zwar keinen rechten Zweck, aber es peinigt mich so sehr, dass ich mich dessen entlasten muss: meine Novelle Tamangur ist auf eine furchtbare Weise verstümmelt, und dennoch unter meinem guten Namen veröffentlicht worden. Ich weiss ja, dass es Ihnen bei der überaus grossen Beanspruchung nicht möglich ist, so kleine Dinge wie Alltagsfliegen zu beachten, aber schliesslich handelt es sich um Kunst; Sprache und Rhythmus. Ob eines Arrivierten oder eines Unbekannten Name unter der Überschrift stehe, sollte dabei so wenig ausmachen wie bei anderen Kunstwerken ... Dann offeriert er eine weitere Novelle zum Abdruck, verlangt jedoch Fahnenabzüge. Aber dem Henker Korrektor auf Gnade und Ungnade will ich es nicht ausgeliefert haben: conditio.
Korrodis Antwort vom 30. April ist deutlich. Verehrter Herr Felix! Wenn Sie, da Sie kein H. v. Kleist sind, Satzverkropfungen zum besten geben, sollten Sie immerhin bedenken, dass der Leser auch noch existiert und sich gewisse Satzungetüme verbietet. Ich habe amputiert und nichts als Mühe mit Ihrer Novelle gehabt ...
Darauf schrieb Paul Felix am 1. Mai: Mein lieber Herr Mitmensch Korrodi, um des wundervollen Klein-Kinder-Schmollens willen, das aus Ihrem Schreiben den eigenwilligen Dichter wie eine Krähe den aufgebäumten Bussarden anhässelet, will ich mich auch Ihres Stolzes freuen, mit dem Sie das Ihnen anvertraute Schriftgut verstümmeln, um sich dabei wie weiland Doctor Eisenbarth vorzukommen, der auch «amputiert» hat, wie Sie sich so schön ausdrücken, wohl um in der Fakultät zu bleiben. . . . Ihr liebes Vorsätzlein «wenn Sie, da Sie kein H. v. Kleist sind» kann nur dann einen Sinn haben, wenn Sie, da Sie kein J W v. Goethe sind, daran gedacht haben, dass sich, weil sich dieser an ihm rieb, jener am Strand erschoss. Ich will Ihnen gar keine Mühe mit meinen Novellen mehr machen . . . Meines Wissens erschien in der «NZZ» kein weiterer Text von Paul Felix.
NACHLASS
Paul Felix hat nur wenige Texte veröffentlichen können, geschrieben aber hat er sehr viele. In seinem Nachlass, der zweifellos nur einen Teil seiner Arbeiten umfasst, da er besonders im Alter laufend Texte fortgeworfen hat, befinden sich Typoskripte von gut 60 meist kürzeren Novellen, etlichen Gedichten und knapp 60 Essays und Vorträgen. Während in den früheren Texten doch hie und da klare, vielleicht sogar schöne Passagen stehen, sind die späteren Arbeiten in immer knorrigerem, pompöserem und verquälterem Stil abgefasst. Sie sind deswegen eine oft sehr mühsame Lektüre. – In seiner letzten Wohnung, ebenerdig an der Eidmattstrasse 7, stand ein Tisch mit einer riesigen Schreibmaschine. Paul Felix arbeitete verbissen, liess aber die vollgeschriebenen Blätter einfach auf der Rückseite des Tisches zu Boden fallen, bis ein grosser Haufe dort lag. Den beiden Frauen, die ihm aufwarteten, und ihn deswegen zur Rede stellten, antwortete er: «Deet hät's am meischte Platz», und als einer seiner Freunde ihn fragte, was er eigentlich schreibe, griff er in den Haufen hinein, packte einen Wisch Blätter, streckte sie ihm hin und knurrte: «Da, chasch ja sälber läse!» – Er selber hat seine Blätter kaum mehr gelesen; war der Haufe zu gross geworden, schmiss er das Papier fort, und eines Tages sagte er: «Ich ha s Räne uufggää.» – Er hatte resigniert.
In späteren Jahren wohnte Paul Felix im Haus Eidmattstrasse 7 (vorne rechts).
SCHREIBER DER «FREIEN VEREINIGUNG WÄDENSWIL»
Von einer anderen Seite lernen wir den Schriftsteller Felix in seinem Amt als Schreiber der Freien Vereinigung Wädenswil kennen. Die Freie Vereinigung ist am 25. Januar 1925 gegründet worden, bereits vier Jahre später hat sie mit der Lesegesellschaft Wädenswil fusioniert. § 1 ihrer Statuten bezeichnet sie als Verein, der durch geeignete Veranstaltungen das geistige und gesellschaftliche Leben pflegen will. Paul Felix formuliert das im Neujahrsblatt 1926 so: Mit Grund hat daher der nachmalige Obmann der freien Vereinigung gesagt, dass es vollständig nebensächlich sei, aus welchem Lebensgebiet die Darbietungen stammen, mit denen das eine, das andere Mitglied der freien Vereinigung, oder ein eingeladener auswärtiger Referent die übrigen Mitglieder als Hörer darüber unterhalte, was gerade seinem Leben Inhalt und Wert verschaffe. Wichtig allein sei, dass durch die freie Vereinigung eine Stätte geschaffen werde, wo . . . der Wert des Lebens eines jeden Hörers ... vergrössert und bereichert werde.
Als Schreiber hat Paul Felix den gesamten Schriftverkehr der Vereinigung geführt. In einem übervollen 8-cm-Ordner sind Durchschläge und einige Originale gesammelt. Daraus nun ein paar Müsterschen. Sie zeigen den streitbaren, mitunter rechthaberischen, aber auch den skurrilhumorvollen Paul Felix. Zunächst zum streitbaren.
Der Text stammt aus dem Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 25. April 1927.
Dr. Ochsner erkundigt sich unter der Hand, wo denn die 111 fr. hingekommen seien, die der Schreiber für die Konzerte gebraucht habe. Der hellhörige Schreiber am anderen Ende des Tisches hat Auskunft gegeben: die Belege lagen bei, wo Belege aufzubringen waren. Für Trinkgelder bei Flügeltransport Konzert Reitz, für Bewirtung, Blumensträusse, Telephone Jecklin, Plakatverträgerei (die dem Schreiber allemal im letzten Augenblick übergeben wurde), Briefporti etc. etc. hat der Schreiber nicht noch extra Belege beigebracht, weil er irrtümlicher Weise meinte, die freie Vereinigung wünsche Betätigung des Geistes, nicht Bestätigung der Trinkgelder, was beides noch nachzuholen ist.
Beim nächsten Text geht es um ein Manuskript, welches offenbar im «Allgemeinen Anzeiger vom Zürichsee» verstümmelt wiedergegeben worden ist. Paul Felix verlangte es zurück, man wollte es ihm aber nicht geben. (Mit welchen Worten er es zurückverlangt hat, wissen wir allerdings nicht.)
Die mir als dem Vertreter der freien Vereinigung widerfahrene rohe Behandlung: Hinauswurf unter Androhung manueller Gewalt (gegen die man sich im Haus des Übeltäters bekanntlich «mangels Zeugen» nur auf die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung für Hausfriedensbruch hin wehrt; jenseits der Schwelle stehe ich zur Verfügung) und die Überschüttung mit Invectiven so ziemlich niedrigster Sorte buche ich auf Rechnung Freie Vereinigung, weil das alles ganz unmöglich mich persönlich betreffen kann, denn ich hatte mit den Herren lediglich zu tun als der
Vertreter der Freien Vereinigung Wädenswil
Vertreter der Freien Vereinigung Wädenswil
Die folgenden drei Texte zeigen seinen Humor, der allerdings mitunter recht sarkastisch sein konnte.
Zunächst ein Ausschnitt aus dem Sitzungsbericht Ausschußsitzung vom Sonntag, dem 28. November 26, im «Schiffli», oben.
Damaliger Stand der Mkk (Musikkommission) Organisation: Frl. Keller, Quästor. Mkk.Mitglieder: Müller, Dr. Graf, Funk, Frau Stüssi, gleich gestellt.
Nach zwei Stunden eifriger Debatte Beschluss, die Organisation neu zu gestalten, nämlich: Frl. Keller, Quästor,: Mkk gleichgestellte Mitglieder Müller, Dr. Graf, Funk, Frau Stüssi.
Der Anfang eines Briefes an den abwesenden Obmann lautet, den Anfangszeilen der Odyssee nachgebildet (allerdings mit acht Hebungen):
Tröste mir, Muse, den Mann, dem ich melde menschlicher Torheit Wirken und Walten;
wie es zerstörend umkehrt in Feindschaft, was wir in Treuen zum Besten bereitet! Dir, der du auszogst, am Stock schon die Rebe wieder zu adeln, dass sie des reiner Freude uns spende, Gruss dir zuvor!
Und so geht das weiter über zwei Seiten lang.
Zum Schluss folgt ein weiterer Briefanfang. Der Empfänger, Prof. Dr. Fritz Kobel, war damals Direktor der «Eidgenössischen Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau», der heutigen Forschungsanstalt. Im Volksmund hiess und heisst diese Institution einfach «das Schloss», und von ihren Angestellten sagt man: «Si schaffed im Schloss obe.»
8. Juli, 1927
Herrn Dr. F. Kobel,
Schlosser und Obmann
Mein lieber Herr Doctor & Bestäuber (oder pflanzt man Reben anders fort?) heute nacht um zwölf und zehne kam ich vom letzten Zug heim und war mit Vergnügen bereit, den Fackel unseres Quästoren zu lesen – aber oh Graus, da wusste ich nicht mehr, war ich oder er bezochen. Sintemalen jedoch die allgemeine Geldverknapperung (das ist ein von den Nationaloekonomen, erfundenes Wort) mir nicht dazu gelangt hätte, muss es an jenem gelegen haben.
EINE WELTREISE
Mitten in den krisengeschüttelten dreissiger Jahren wurde Paul Felix von einem Freund, Jakob Rohner in Zürich, auf eine Weltreise zu zweit eingeladen. Er hätte anschliessend einen Bericht über das Unternehmen schreiben sollen, doch dazu ist es offenbar nie gekommen, jedenfalls erinnert sich niemand daran, irgendwo so etwas gesehen zu haben, und im Nachlass findet sich keine Zeile davon.
Die Reise wurde von der «Passage- und Auswanderungs-Agentur Ernest-L. Charles, Geneve» zusammengestellt. Sie begann am 30. Januar 1937 in Boulogne-sur-Mer und sollte am 23. Juli in Marseille enden. Die beiden Weltreisenden fuhren zunächst in drei Wochen mit einem englischen Schiff nach Buenos Aires, hierauf mit Bahn und Auto quer durch den Kontinent nach Santiago de Chile, hierauf mit Schiffen über San Francisco und Honolulu nach Kobe in Japan. Dort folgte ein «Inlandprogramm», welches von «unserem Bureau in Kobe zusammengestellt» worden war. Über Shanghai und Hongkong führte die Reise nach Singapore, wo ein weiteres zwölftägiges «Inlandprogramm» auf Java, Bali und Sumatra folgte. Von Calcutta aus war ein drittes durch Indien vorgesehen, und zum Schluss wollte man durch den Suez-Kanal nach Marseille fahren.
In China entstanden zwischen Rohner und Felix Meinungsverschiedenheiten über die Weiterreise. Herrn Rohner – so berichtete Paul Felix einem Freund – seien die japanischen und chinesischen Städte gründlich verleidet gewesen. Ob man nicht sich lieber in Europa umsehen wolle, habe er vorgeschlagen. Doch Paul Felix wollte sich die einmalige Gelegenheit, China, Indonesien und Indien wenigstens kurz zu besuchen, nicht entgehen lassen. So trennten sie sich eben: Rohner fuhr heim, und Felix absolvierte – auf Rohners Kosten - das ganze restliche Programm allein.
Das chilenische General-Konsulat verlangte ein Leumundszeugnis, welches am 27. Januar 1937 ausgestellt worden ist. Der Gemeinderat Wädenswil bezeugt darin, «dass Felix, Paul, Schriftsteller, ... zur Zeit in Zürich sich aufhaltend, keiner kommunistischen Partei angehört», und zu den Vorstrafen bemerkt das Zeugnis: «Laut hierseitiger Strafkontrolle keine.» Der Zürcher Arzt Ant. Zendralli befand ihn als «gesund und frei von Infektionskrankheiten», und die Anomalien der Wirbelsäule, welche aus der Kindheit herrührten, bezeichnete er als heute belanglos.
Im Nachlass von Paul Felix liegt ein Bogen einer japanischen Zeitung. Neben einer ganzen Anzahl weiterer Herren ist – allein und mit viel grösserem Bild – der «bedeutende Schweizer Schriftsteller Paul Felix» vorgestellt. Wie wohl Rohner und er es fertiggebracht haben, dass ein solcher Artikel geschrieben und gedruckt worden ist?
Ausschnitt aus einer japanischen Zeitung aus dem Jahre 1937, mit Text über und Foto von Paul Felix.
LEBENS UMSTÄNDE
Paul Felix wohnte zunächst in Wädenswil, später an verschiedenen Adressen in der Stadt Zürich, ab 1919 wieder in Wädenswil, nach 1938 für lange Jahre in Stäfa und im Alter erneut in Wädenswil.
Er hatte durchaus die Eigenschaften eines Bohemiens, eines interessanten und geistreichen Gesellschafters, dessen unkonventionelle, oft auch ärgerliche Seiten man ihm als eine Art Narrenfreiheit gerne nachsah. Immer wieder fand er Freunde und Gönner, die ihm halfen, ihn einluden, ihm diese und jene Unterstützung angedeihen liessen (siehe Weltreise!). Sein Vater hat ihm eine Rente ausgesetzt, und an der Eidmattstrasse 7, wo er im Alter lebte, hat er keinen Mietzins entrichten müssen.
In diesem Zusammenhang ist auf das hartnäckige Gerücht einzutreten, Paul Felix habe zwei zu recht sehr angesehenen Wädenswilern ihre Dissertation verfasst und sei dafür von ihnen lebenslänglich finanziell unterstützt worden. Zumindest der eine von ihnen – vom anderen weiss ich es einfach nicht – hat ihm tatsächlich immer und immer wieder geholfen, und in seinem Hause konnte er ein- und ausgehen, fast wann und wie es ihm beliebte. Dass er die beiden Dissertationen geschrieben habe, halte ich für ausgeschlossen. Beide behandeln Themata aus dem Bereich von Wirtschaft und Nationalökonomie, aus Gebieten also, in denen Paul Felix, der ein Arztstudium abgebrochen hatte und von eher unsteter Natur war, unmöglich sattelfest sein konnte. Ein Stilvergleich zwischen der einen dieser Dissertationen und vielen Texten von Paul Felix – nicht nur literarischen – zeigt keine Verwandtschaft. Möglich wäre, dass er diese beiden Arbeiten auf sprachliche und orthographische Richtigkeit durchgesehen hätte; aber das wird ja wohl noch erlaubt sein! – Übrigens: spricht es nicht für den Schriftsteller Paul Felix, dass man ihm das Schreiben zweier Dissertationen überhaupt zugetraut hat?
Gegen das Alter hin wurde er noch skurriler, unnahbarer, unberechenbarer und lehnte sich gegen alles und jedes auf, was mit der Gesellschaft zu tun hatte. (Ein Freund berichtet, er habe im Alter keine Steuererklärungen mehr ausgefüllt, Steuererklärungen habe er einfach weggeworfen.) Die Gesellschaft hat den Schriftsteller Felix nicht zur Kenntnis nehmen wollen, sie hat ihn abgelehnt, was brauchte er sich noch um sie und ihre Vertreter zu kümmern? – Man spürt hinter der Wut die Resignation: «Ich has Räne uufggää.» Von da her, meine ich, seien auch seine gelegentlich unflätigen Beschimpfungen von Personen und Institutionen zu verstehen.
Er zog sich immer mehr zurück, arbeitete an Texten, die er selber nicht mehr ernst nahm, sonst hätte er sie nicht einfach ungelesen weggeworfen. Auf dem Tisch lagen Zigarettenstummel, Esswaren, Geschirr und irgendwo Wäsche. Vereinsamt und verkommen.
Gegen Ende des Jahres 1957 fühlte er sich so sehr unwohl, dass er zu seiner Schwester, der Kindergärtnerin «Tante Mimi», zog. Wenige Tage später, am 2. Januar 1958, verstarb er im Alter von gut 72 Jahren.
ANEKDOTEN
Einer meiner Gewährsleute, ein guter Freund von Paul Felix, hat eine ganze Reihe von Begebenheiten erzählt, die er grösstenteils selber miterlebt hat. Zwei davon sollen hier mitgeteilt werden.
Die Einladung
Paul und ich waren eingeladen, ganz nobel: reich gedeckte Tafel, illustre Gäste, und das Essen in diesem Haus vorzüglich. Paul hatte den Rappel. Als ihm das gegenseitige Sich-Vorstellen und die dabei unumgängliche Konversation der vielen Gäste wegen zu lange dauerte, setzte er sich als einziger einfach an den Tisch. Bald trugen die Bedienten die ersten Schüsseln auf Paul schöpfte sich ungeniert den Teller randvoll, und während sich die letzten Gäste noch kaum gesetzt hatten, begann er zu essen. Ich machte ihn auf seinen groben Fauxpas aufmerksam. Da knurrte er mich an: «Tume Lööli, ich ha Hunger, und wän ich Hunger ha, so friss i. Die tume Sieche seled umeschnure, ich frisen iez.» Man habe ihn mehr oder weniger belustigt gewähren lassen.
Das zweite Beispiel ist ein richtiger Lausbubenstreich, der, wenn man sich die Sache genau überlegt, eigentlich kaum schiefgehen kann, vorausgesetzt, man habe die Unverfrorenheit und die Überzeugungskraft eines Paul Felix.
Der Kollege
Eines Nachmittags traf ich Paul im Zürcher Hauptbahnhof Er nahm mich am Arm und zog mich ins Bahnhofbüffett. Kaum hatten wir uns gesetzt, forderte er mich auf, einen halben Liter Roten zu bestellen. Auf meine Frage, ob er Geld habe, sagte er: «Du wirsch wol na en halbe Liter vermöge!» Ich hatte aber nur noch einen Franken achtzig bei mir und schlug ihm deshalb ein Glas Bier vor. Das lehnte er ab, er wolle jetzt Wein trinken und kein Bier. Als ich ihm erklärt hatte, mein Geld reiche wirklich nicht, zuckte er mit den Achseln und schaute sich in der Halle um. Nach kurzer Zeit deutete er auf einen Herrn, der allein an einem Tischchen sass. «Gseesch de säb deet äne ?» Ich nickte und fragte, wer es sei. « Weis ich doch nüd», antwortete er, «aber dee zaalt öis jez dänn en halbe Liter.» Das konnte ich denn doch nicht glauben. Wie sollte auch ein wildfremder Mann auf die Idee kommen, uns Wein zu zahlen? «Chaschja luege, wie me daas macht.»
Damit stand er auf, trat zu dem Unbekannten, klopfte ihm kollegial auf die Schulter, setzte sich neben ihn und sagte: «Sali, wie gaat's der au? Scho lang nüme gsee.» Der Fremde schaute Paul verdutzt an; er kenne ihn nicht, er müsse ihn mit jemandem verwechslen. Darauf Paul: «Ja, waas ächt! Mir sind doch mitenand is Gymi ggange. Das isch ja e Schand, das du daas nüme weisch.» Der andere bestätigte, dass er das Gymnasium besucht habe, beteuerte aber, sich nicht mehr an ihn zu erinnern. «En Affeschand isch so öppis ! Da gaat me soo mängs Jaar mitenand is Gymi, und duu weisch nüüt me!» Er müsse sich wirklich schämen, gab er zu, doch er könne sich einfach nicht mehr an ihn erinnern. «Da wott me Widersee fiire», fuhr Paul entrüstet fort, «und Duu weisch vo Nüütem me. Schäm di ! Und daas isch en eemaalige Gymnasiascht !» Der Fremde schämte sich tatsächlich, dass ihn sein Gedächtnis derart im Stich lasse, und in seiner Verstörtheit lud er Paul zu einem Halben Roten ein.
Während er bestellte, winkte mich Paul an den Tisch. Wir stellten uns gegenseitig vor und stiessen bald darauf an. Der Nachmittag verlief äusserst angenehm, denn Paul war ein vorzüglicher Unterhalter. Als wir uns endlich verabschiedeten, hatten wir auf Kosten des Fremden drei Halbe getrunken.
WÜRDIGUNG
In der «Zürichsee-Zeitung» vom 17. September 1955 erschien – verfasst vom Verleger Ulrich Gut – die folgende Geburtstagsgratulation.
Paul Felix siebzigjährig
In aller Stille begeht in Wädenswil der Dichter Paul Felix seinen siebzigsten Geburtstag. Wer kennt ihn nicht, am See, die markante, leicht gebeugte (nicht vom Alter) Gestalt mit dem Charakterkopf! Paul Felix, Sohn eines angesehenen Arztes zu Wädenswil, ist noch heute Bündner Bürger – er, der leidenschaftlich seinen Zürichsee liebt und ihn kennt wie wenig andere, und ihm nachspürt mit Wort und Feder. Seinem Bündnerstolz entrichtete er in früheren Zeiten Tribut durch die Beifügung des Wortes «Parpan» zu seinem Namen. Parpan ist der Flecken, von wo der starke, knorrige Baum ursprünglich stammt. Er hat viel geschrieben und gedichtet, unser Paul Felix und verhältnismässig wenig veröffentlicht. Bekannt und beliebt ist seine feinnervige, liebevolle Novelle «Das Seidenlied» (die in diesem Blatte einst als Feuilleton erschien) sowie die Bündner-Erzählung «Schelmenbüschels». Immerhin verspricht er uns weitere Veröffentlichungen – wir wollen sehen und uns freuen! Paul Felix hat die ganze weite Welt bereist und nun aus allen weiten Horizonten die weichen Linien unserer Ufer, der heimatlichen Rebberge und der beiden den See begrenzenden Hügelketten erwählt. Nach Jahren in Stäfa, das ihm lieb ist, zog er nach Wädenswil, das ihm – will er oder will er nicht – Heimat ist. Und dieweil er sommers und winters den See fleissig überquert, sinnt er, schreibt und schaut – und trinkt wohl auch ein gutes Glas Clevner: «Zum Wohl, Paul Felix!» UG.
Hans Scheidegger